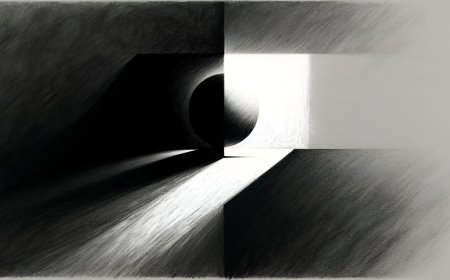Die Entzauberung: Fragen, die zurück zur Wirklichkeit führen
Teil 3 analysiert die Entzauberung der „Marktstraße“ durch präzise Nachfragen. Ein öffentlicher Fragenkatalog zwingt das dominante Narrativ zur Prüfung – und macht sichtbar, wo Erzählung endet und überprüfbare Wirklichkeit beginnt.

Kapitel 3: Transparenz durch offenen Verteile
Die eigentliche Kraft des Fragenkatalogs entfaltet sich nicht allein in seinen präzisen Formulierungen, sondern in seiner Verbreitung. Er ist kein Schreiben, das zwischen Absender und Adressat hin- und hergeht und dann vielleicht in einer Schublade verschwindet. Er ist bewusst so angelegt, dass er öffentlich zugestellt wird – mit einem offenen Verteiler.
Das bedeutet: Nicht nur die Bürgermeisterin erhält die Fragen, nicht nur der Stadtvertreter Kehrle. Der Katalog geht zugleich an die Stadtverwaltung, an den Landrat, an den Kreistag, an die Fraktionen im Landtag, an das Innenministerium, sogar an den Verfassungsschutz und den Bürgerbeauftragten. Und auch die Presse ist mit eingebunden.
Damit entsteht eine Art Schutzbrief. Wer den Katalog ignoriert, weiß, dass andere Stellen informiert sind. Niemand kann später sagen: „Davon habe ich nichts gewusst“ oder „das Schreiben ist nicht angekommen“. Das CC-Prinzip ist nicht nur formale Höflichkeit, sondern ein strategisches Mittel gegen das Vergessen und Verdrängen.
Diese Transparenz verändert die Dynamik. Aus einer bilateralen Nachfrage wird ein öffentlicher Vorgang. Aus einem privaten Zweifel wird ein dokumentierter Schritt im politischen Raum. Und genau das entzieht dem Narrativ seine Schutzräume: Die Fragen stehen jetzt nicht mehr nur im Kopf der Kritiker, sondern im offiziellen Register der Kommunikation.
So wird aus einem Verteiler ein Instrument politischer Reinigung. Er sorgt dafür, dass das, was gesagt wird, überprüfbar bleibt, und dass niemand sich in die Ausrede retten kann, uninformiert gewesen zu sein.
Kognitive Dissonanz im öffentlichen Raum
Serie – Direkt springen: Teil 1 · Teil 2 · Teil 3
Teil 1: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7
Inhaltsverzeichnis: Teil 1 · Teil 2 · Teil 3
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)