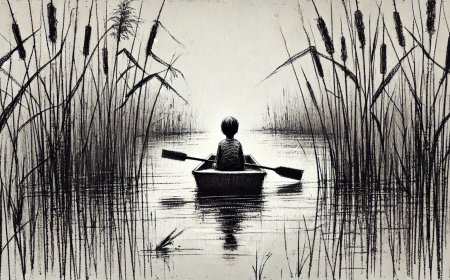Die Entzauberung: Fragen, die zurück zur Wirklichkeit führen
Teil 3 analysiert die Entzauberung der „Marktstraße“ durch präzise Nachfragen. Ein öffentlicher Fragenkatalog zwingt das dominante Narrativ zur Prüfung – und macht sichtbar, wo Erzählung endet und überprüfbare Wirklichkeit beginnt.

Kapitel 4: Auflösung der kognitiven Dissonanz
Die Stärke des Narrativs zur Marktstraße lag von Anfang an darin, dass es ein Vakuum besetzte. Dort, wo Beweise fehlten, traten Worte an ihre Stelle. Geschichten, Bilder und Schlagworte füllten die Leere, das Vakuum und gaben den Anwesenden das Gefühl, etwas in der Hand zu haben. So entstand jene Spannung zwischen fehlender Realität und starker Vorstellung, die man als kognitive Dissonanz beschreibt.
Der Fragenkatalog setzt genau hier an. Er konfrontiert das Vakuum mit Präzision. Statt unbestimmter Worte verlangt er nach belegbaren Angaben: Was? Wann? Wo? Wer? Damit stellt er die Mechanik der Dissonanz auf den Kopf. Wo vorher Unsicherheit herrschte, fordert er Klarheit. Wo zuvor Gefühle genügten, verlangt er Fakten.
Das hat zwei mögliche Folgen. Entweder die Vorwürfe lassen sich konkretisieren – dann treten sie aus der Grauzone heraus und können geprüft werden. Oder sie lassen sich nicht konkretisieren – dann zeigt sich, dass das Vakuum nichts anderes war als eine Erzählung.
Beides ist eine Form der Auflösung. Denn Dissonanz lebt vom Schwebezustand, vom „Vielleicht“ und „Man sagt“. Sobald eine klare Antwort vorliegt – oder die Abwesenheit einer solchen sichtbar wird – bricht die Spannung. Der Raum für vage Andeutungen schließt sich.
Damit wirkt der Katalog wie ein Prüfstein. Er zwingt dazu, die Grenze zwischen Wirklichkeit und Vorstellung sichtbar zu machen. Und er zeigt, dass die eigentliche Kraft der Erzählung nicht in den Fakten lag, sondern in ihrer Unüberprüfbarkeit.
Kognitive Dissonanz im öffentlichen Raum
Serie – Direkt springen: Teil 1 · Teil 2 · Teil 3
Teil 1: 1 · 2 · 3 · 4 · 5 · 6 · 7
Inhaltsverzeichnis: Teil 1 · Teil 2 · Teil 3
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)