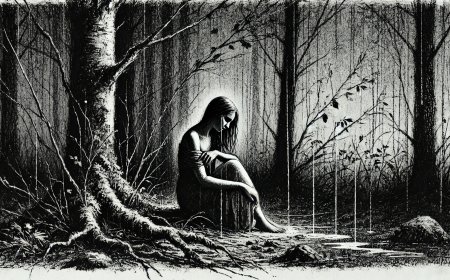Ein Konzept mit Zukunft - Integratives Schülerpraktikum im Fotoatelier
Ein zweiwöchiges Praktikum für ukrainische Jugendliche im Fotoatelier Loitz wird zum Modell gelingender Integration: mit einfacher Sprache, klarer Struktur und sichtbaren Ergebnissen. Teil I zeigt, wie die Sprache Brücken baut – und was Schulen daraus machen können.

Kapitel 5: Didaktische Entscheidung - Einfach und zweisprachig
Wenn Sprache nicht selbstverständlich ist, braucht Lernen eine andere Form. Es reicht dann nicht, Inhalte zu erklären – man muss sie zugänglich machen. In diesem Praktikum war von Anfang an klar: Es braucht einfache Worte, eine klare Struktur und vor allem: zwei Sprachen. Nicht als Kompromiss, sondern als Brücke. Denn wer etwas verstehen soll, muss sich angesprochen fühlen – auch sprachlich.
Einfache Sprache – kurze Sätze, aktive Verben, ein Gedanke pro Satz
Sprache kann tragen – oder sie kann stolpern. Besonders dann, wenn zwei Sprachen nebeneinanderstehen, neue Begriffe auftauchen und das Thema selbst schon anspruchsvoll ist. Genau deshalb wurde von Anfang an auf einfache Sprache gesetzt. Nicht, um Inhalte zu vereinfachen – sondern um sie klarer zu machen.
Die Regeln waren einfach: Ein Satz, ein Gedanke. Keine unnötigen Nebensätze, keine Ketten aus Fachbegriffen. Stattdessen kurze, klare Sätze. Mit aktiven Verben. Mit Worten, die man verstehen kann, ohne lange überlegen zu müssen. Nicht banal, aber verständlich.
Diese Entscheidung war mehr als Stil. Sie war Teil der Methode. Denn wer lernen soll, muss sprachlich mitkommen. Nur dann kommt auch der Inhalt an. Auch schwierige Themen – etwa Kameratechnik, Lichtführung oder rechtliche Fragen – lassen sich gut erklären, wenn man sie Schritt für Schritt ordnet. Und wenn man bereit ist, sich auf das Tempo der Lernenden einzulassen.
Einfache Sprache war in diesem Praktikum kein Notbehelf. Sie war eine Einladung. Eine stille Botschaft: Du musst nicht alles wissen. Aber du darfst alles verstehen. Und du darfst fragen – jederzeit.
So wurde Sprache nicht zur Hürde. Sondern zur Brücke. Zwischen Begriff und Bild. Zwischen Gedanke und Handlung. Zwischen zwei Sprachen, zwei Welten – und zwei Menschen, die bereit waren zu lernen.
UA / DE – erst die Muttersprache, dann das Deutsche
Von Anfang an galt eine klare Reihenfolge: Zuerst wird in der Muttersprache erklärt – dann folgt das Deutsche. Nicht aus Höflichkeit, sondern aus Überzeugung. Denn wer zuerst in der eigenen Sprache versteht, kann das Neue gezielter aufnehmen. Wenn man zu früh wechselt, bevor etwas wirklich angekommen ist, entsteht oft Unsicherheit. Und manchmal auch Rückzug.
Deshalb wurde jeder neue Begriff, jedes Thema, jedes Handblatt zuerst auf Ukrainisch erklärt. Erst danach kam das Deutsche dazu – begleitet von Beispielen, kurzen Sätzen und Bildern. So entstand eine Verbindung zwischen dem Vertrauten und dem Neuen. Zwischen dem inneren Verstehen – und dem äußeren Benennen.
Damit es nicht zu viel auf einmal wurde, galt eine feste Regel: Zehn neue Begriffe pro Tag – nicht mehr. Das brachte Ruhe in den Lernprozess. Es gab Zeit, jeden Begriff zu wiederholen, auszusprechen und aufzuschreiben. Und ihn in einen Satz zu setzen. Jeder neue Ausdruck wanderte ins eigene Glossar – zweisprachig, parallel geführt.
So wuchs der Wortschatz nicht einfach in die Breite – sondern in die Tiefe. Die Jugendlichen schrieben mit der Hand. Und verankerten es im Kopf.
Dieses Prinzip – erst Ukrainisch, dann Deutsch – war mehr als eine sprachliche Entscheidung. Es war eine Art zu denken: Erst Herkunft, dann Ankommen. Erst Sicherheit, dann Übergang. Erst Verstehen – dann Sprache.
Begriff = Bild = Satz – Fachsprache anschaulich machen
Ein einzelnes Wort reicht oft nicht aus, um wirklich zu verstehen, worum es geht. Das gilt besonders dann, wenn das Wort neu ist, aus einer anderen Sprache kommt oder mehrere Bedeutungen haben kann. Deshalb wurde im Praktikum jeder Fachbegriff auf drei Arten erklärt: als Wort, als Bild und als Satz.
Das Vorgehen war einfach: Ein technischer Begriff wurde nicht nur gesprochen oder geschrieben – sondern auch sichtbar gemacht. Für jeden Ausdruck gab es eine kleine Zeichnung, die die Grundidee verdeutlichte. Dazu kam ein kurzer Beispielsatz, leicht verständlich und in einfachem Deutsch. Und wenn es passte, wurde der Begriff auch gleich im Alltag angewendet.
Ein Beispiel: Das Wort „ISO“. Es wurde nicht nur als Einstellung an der Kamera beschrieben, sondern mit einem Bild verbunden – zum Beispiel einem Auge, das bei Dunkelheit weiter offen ist. Der Satz dazu lautete: „Hohe ISO macht das Bild heller – aber es kann auch anfangen zu rauschen.“ Ergänzt wurde das Ganze durch eine praktische Frage: „Wie hell ist es im Raum – und was bedeutet das für die Kameraeinstellung?“
Dieses Zusammenspiel half, abstrakte Wörter begreifbar zu machen. Das Bild schuf einen Anker fürs Erinnern. Der Satz zeigte, wie das Wort im Zusammenhang klingt. Und das Beispiel holte den Begriff in die Wirklichkeit.
So wurde diese Dreiteilung – Begriff, Bild, Satz – zu einer stillen Grundlage im Lernalltag. Niemand musste sie ständig benennen. Aber sie war da. Und sie wirkte. Denn Sprache muss nicht einfacher sein, um verstanden zu werden. Sie muss ankommen – im Kopf, im Bild und im gesprochenen Satz.
Handouts – zweisprachig gespiegelt, klar gegliedert, praxisnah
Damit das, was besprochen wurde, nicht gleich wieder verloren geht, war schriftliches Material ein wichtiger Teil des Praktikums. Zu jedem Thema gab es einen eigenen Handzettel – zweisprachig gestaltet, übersichtlich aufgebaut. Auf der einen Seite stand der Text auf Ukrainisch, auf der anderen auf Deutsch. Keine langen Absätze, kein Kleingedrucktes. Stattdessen: klar gegliederte Stichpunkte, kleine Zeichnungen, einfache Beispiele.
Die Themen reichten von rechtlichen Grundlagen über Kamera, Licht und Ton bis hin zur Bildabfolge und Planung. Jeder Abschnitt enthielt die wichtigsten Begriffe – in beiden Sprachen. Dazu ein Beispielsatz, ein Bild zur Orientierung und Platz für eigene Notizen oder Fragen. Die Handzettel waren so gemacht, dass man sie mitnehmen, ergänzen und immer wieder anschauen konnte.
Diese gespiegelt zweisprachige Form hatte einen großen Vorteil: Man konnte selbst vergleichen, ohne ständig nachzufragen oder im Wörterbuch zu blättern. Alles stand nebeneinander – in gleichem Umfang, mit gleichem Wert. Das zeigte: Beide Sprachen zählen. Beide dürfen benutzt werden. Beide helfen beim Lernen.
Im Laufe der zwei Wochen wurden die Handzettel nicht nur gelesen, sondern auch weiterbearbeitet. Man schrieb etwas dazu, unterstrich wichtige Stellen oder zeichnete kleine Skizzen. So wurden aus Vorlagen persönliche Arbeitsmittel – mit eigener Handschrift.
Ein Konzept mit Zukunft – Integratives Schülerpraktikum im Fotoatelier
Direkt springen: Vorwort · Kapitel 1–12 · Abschließende Worte
↑ Zurück zum Seitenanfang Kapitel 5
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)