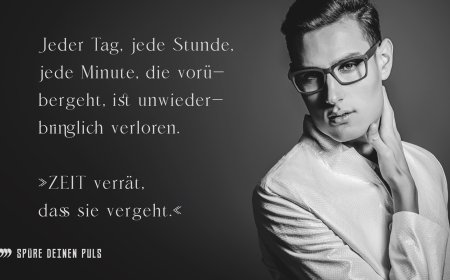Ein Konzept mit Zukunft - Integratives Schülerpraktikum im Fotoatelier
Ein zweiwöchiges Praktikum für ukrainische Jugendliche im Fotoatelier Loitz wird zum Modell gelingender Integration: mit einfacher Sprache, klarer Struktur und sichtbaren Ergebnissen. Teil I zeigt, wie die Sprache Brücken baut – und was Schulen daraus machen können.

Kapitel 2: Einstieg - Meine Philosophie
Wenn junge Menschen lernen, braucht es mehr als Wissen. Es braucht Zeit, Geduld und einen Ort, an dem man sich sicher fühlt. Genau das war der Ausgangspunkt für dieses Praktikum: langsam anfangen, gemeinsam denken – und erst dann ins Tun kommen.
Freiberufliche Arbeit unter dem Namen DREIFISCH
DREIFISCH steht für freies, selbstständiges Arbeiten mit Fotografie, Film und Gestaltung – mit einem hohen Anspruch an Sorgfalt und Genauigkeit.
Das Atelier ist dabei nicht nur ein Ort für Aufträge, sondern ein Raum, in dem Geschichten mit Bildern erzählt werden. Hier wird genau hingeschaut. Es wird so gearbeitet, dass man dem, was gezeigt wird, mit Respekt begegnet – und auch den Worten, die das Bild begleiten.
Es geht nicht einfach nur um Technik oder um schöne Bilder. Es geht um eine bestimmte Art, die Welt zu betrachten: aufmerksam, offen, mit dem Bewusstsein, dass jedes Bild etwas bedeutet.
Wer fotografiert oder filmt, entscheidet mit, was sichtbar wird – und was vielleicht im Verborgenen bleibt. Und genau deshalb ist jede gestalterische Arbeit auch mit Verantwortung verbunden.
Ob beim Fotografieren, beim Schneiden oder beim Gestalten eines Layouts: Es geht immer darum, etwas sichtbar zu machen, das sonst vielleicht übersehen würde.
An diesem Punkt trifft das Gestalten auf eine Aufgabe, die über das Bild hinausgeht. Genau dort beginnt die Idee, dass Gestaltung nicht nur ein Beruf ist, sondern auch ein Weg, sich mit anderen zu verbinden – über das, was man sieht, und über das, was man zeigen möchte.
Integration braucht Raum, Zeit und Begegnung
Integration ist kein Ziel, das man einmal erreicht und dann abhaken kann. Sie braucht Zeit. Sie wächst langsam, Schritt für Schritt. Und wie alles, was wirklich wachsen soll, braucht sie Geduld, Wiederholung – und Orte, an denen man etwas ausprobieren darf, ohne gleich bewertet zu werden.
Gerade junge Menschen, die neu in ein Land kommen, stehen oft vor zwei großen Aufgaben: Sie müssen eine neue Sprache lernen. Und sie müssen sich in einem Alltag zurechtfinden, der ihnen noch fremd ist.
Integration heißt in diesem Zusammenhang nicht, sich anzupassen, bis man nicht mehr auffällt. Sondern: gemeinsam etwas Neues entstehen zu lassen – langsam, mit Augenmaß, und auf beiden Seiten.
Am besten gelingt das, wenn man nicht nur darüber spricht, sondern gemeinsam etwas tut. Wenn Integration kein Begriff bleibt, sondern etwas wird, das man im Alltag erleben kann – beim Mithelfen, im Gespräch, in kleinen Abläufen, die man gemeinsam bewältigt.
Langsamkeit ist dabei kein Nachteil. Im Gegenteil: Sie ist notwendig. Wer sich Zeit nimmt, kann genauer hinschauen. Wer das, was gelingt, sichtbar macht, erkennt seinen eigenen Fortschritt – und kann stolz darauf sein. Und wer zusammen mit anderen lernt, lernt nicht nur etwas über Sprache oder Technik, sondern auch über sich selbst und das Miteinander.
Ein Praktikum als Anfang – langsam, zweisprachig, mit viel Zeit für Theorie
Die Idee war einfach: Integration darf man nicht nur erwarten, man muss sie möglich machen. Und damit das gelingen kann, braucht es Orte, an denen man gemeinsam üben kann, wie es geht.
So entstand der Wunsch, ein Praktikum zu schaffen – im eigenen Atelier. Nicht als klassischer Einstieg in einen Beruf, sondern als Gelegenheit, erst einmal anzukommen. Still zu beobachten. Fragen zu stellen. Mitzudenken, ohne gleich etwas leisten zu müssen.
Damit das gelingen konnte, wurde das Atelier angepasst – inhaltlich und sprachlich. Es sollte ein Ort sein, der nicht überfordert, sondern einlädt. Ein Ort, der ruhig ist, klar strukturiert, und an dem man Dinge ausprobieren darf, bevor sie beurteilt werden.
Ein wichtiger Punkt war die Sprache. Das Praktikum wurde von Anfang an zweisprachig gestaltet: Ukrainisch und Deutsch standen gleichberechtigt nebeneinander. Auf den Zetteln. In den Gesprächen. In allen Materialien. Sprache sollte keine Hürde sein – sondern ein Werkzeug, das man benutzen kann. Verständlich. Wiederholbar. Zum Mitnehmen.
Auch bei den Inhalten wurde das Tempo bewusst herausgenommen. Am Anfang stand nicht das Machen, sondern das Verstehen. Die Theorie hatte Vorrang – nicht, weil die Praxis unwichtig wäre, sondern weil sie sonst zu früh kommt. Wer mit Technik sicher umgehen will, muss erst begreifen, was sie bedeutet.
Deshalb wurden die Grundlagen zuerst erklärt, gemeinsam angeschaut, ausprobiert – und erst danach kamen Kamera, Licht oder Ton zum Einsatz.
So entstand ein Rahmen, der nicht auf Leistung setzte, sondern auf Vertrauen. Ein langsamer Anfang – mit Absicht gewählt. Denn ankommen heißt nicht nur, anwesend zu sein. Es heißt: sich orientieren zu dürfen, Fragen stellen zu dürfen, Sprache zu finden – und den eigenen Platz zu entdecken.
Ein Konzept mit Zukunft – Integratives Schülerpraktikum im Fotoatelier
Direkt springen: Vorwort · Kapitel 1–12 · Abschließende Worte
↑ Zurück zum Seitenanfang Kapitel 2
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)