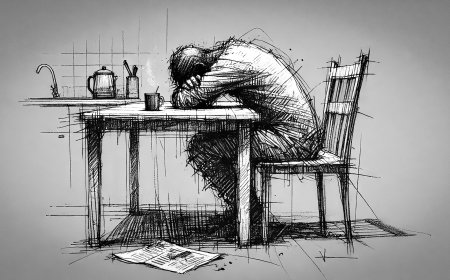Kleine Brücke, großer Stillstand - Warum in Loitz der Weg über den Ibitzbach zum Problem wurde
Die Ibitzbach-Brücke in Loitz wird zum Prüfstein: DDR-Eigenbau (1974), seit 2021 teils gesperrt, nun Ersatz aus Spannbeton. Mehr als Technik: Mit dem Förder- und Kompetenzzentrum (ab 2026/27) entscheidet sie über Teilhabe, sicheren Schulweg von 170 Schüler*innen – und Vertrauen.

Kapitel 2: Als die Brücke noch von Händen gebaut wurde – Ein Blick zurück in die DDR-Zeit
Direkt springen: Kapitel 1–8 · Disclaimer
Man muss sich das vorstellen: Es ist das Jahr 1974. Die DDR feiert ihren 25. Geburtstag, überall im Land laufen sogenannte „Republikgeburtstags-Projekte“. In Loitz, einer bescheidenen Kleinstadt mit Industrie, Handwerk und viel Pragmatismus im Herzen, entsteht in dieser Zeit ein kleines Bauwerk, das im Grunde alles symbolisiert, was man damals unter Gemeinsinn verstand – die Brücke über den Ibitzbach.
Sie war keine Auftragsarbeit eines fernen Ingenieurbüros, sondern ein Werk aus eigener Kraft. Gebaut von den Männern des Loitzer Dübelwerks, die tagsüber Maschinen bedienten und abends Stahlträger verluden. Das war nichts Besonderes – und gerade darin lag die Besonderheit. Diese Männer schufen etwas für ihre Nachbarn, für ihre Kinder, für den Alltag. Es wurde nicht lange gefragt, ob sich das rechnet. Man machte es einfach.
Einer von ihnen war Günter Lander. Heute ist er alt, geht langsam, redet bedächtig. Aber wenn er von „seiner“ Brücke spricht, ist da noch dieser Ton im Hals, den man nicht vergisst: der von Stolz. Nicht laut, aber fest. In einem Interview sagte er über die damals verlegten Betonelemente: „Die Platten sind unverwüstlich.“ Und man glaubt es ihm sofort. Diese Platten, sie waren nicht nur Material – sie waren Zeichen von Handelsfähigkeit. Ein Stück DDR-Baukultur, handfest, funktional, schlicht – aber für die Ewigkeit gedacht.
Die Brücke war kein Monument, kein Prestigeobjekt. Sie war da, wo sie gebraucht wurde: zwischen Wohnhäusern, Spielplatz, Bushaltestelle. Sie verband, was sonst nur mit Umwegen erreichbar gewesen wäre. Und mehr noch: Sie wurde zum Ort, an dem sich das tägliche Leben kreuzte. Schulranzen zogen drüber, Einkaufstaschen, Liebespaare und Arbeitsschuhe. Es war kein besonderer Ort – und doch einer, an dem die Stadt atmete.
Im kollektiven Gedächtnis vieler Loitzer*innen war diese Brücke lange einfach selbstverständlich. So selbstverständlich wie ein Lichtschalter: Man denkt nicht darüber nach, bis es dunkel bleibt. Und genau das ist heute passiert. Sie ist baufällig, fast unbrauchbar – und plötzlich fragt man sich: Wie konnte es so weit kommen mit einem Bauwerk, das uns so lange getragen hat?
Und noch drängender wird diese Frage, wenn man den Blick auf die Zukunft richtet: auf das Förder- und Kompetenzzentrum Loitz (Schule für emotionale und soziale Entwicklung) in der alten Grundschule, das ab dem Schuljahr 2026/2027 wieder Leben in das Quartier bringen soll. Gerade dieser geschichtsträchtige Schulort wird erneut zum Zentrum einer sozialen und pädagogischen Infrastruktur – und die Brücke, einst gebaut von Händen für Füße, wird wieder gebraucht. Nicht symbolisch, sondern ganz konkret.
Denn der tägliche Schulweg von Kindern, Jugendlichen und dem pädagogischen Umfeld führt vom Alten Steintor über die Demminer Straße (mit sicherem Übergang), entlang der alten Stadtmauer und über die Ibitzbach-Brücke weiter in Richtung Greifswalder Vorstadt – eine Route, die durch die Brücke nicht nur verkürzt, sondern vielerorts erst praktikabel wird. Für rund 170 Schüler*innen mit körperlichen oder sozialen Beeinträchtigungen ist das kein Nebenaspekt, sondern Alltag. Begleitet werden sie von Lehrkräften, Sonderpädagoginnen, Erzieherinnen (Internat), Sozialpädagoginnen, Psychologinnen, therapeutischem Fachpersonal sowie Verwaltungs-, technischem und hauswirtschaftlichem Personal. Eine stille Karawane des Alltags, für die diese Brücke ein zentrales Glied der Kette ist – kein Luxus, sondern Notwendigkeit. Und während die Wege feststehen, ist die Parkplatzsituation für Mitarbeitende bis heute ungeklärt – ein Detail, das in der Praxis große Wirkung hat.
Die Frage „Was bleibt von der alten Brücke – und was kommt neu?“ ist damit nicht nur technisch zu beantworten, sondern kulturell: Sind wir bereit, den Geist von 1974 – das Machen, Verbinden, Füreinander – in die Zukunft zu tragen?
Wer diese Brücke heute anschaut, sieht vielleicht nur das rostige Geländer und die Risse im Beton. Wer aber zurückblickt, sieht etwas ganz anderes: einen Ort, an dem die Idee von Gemeinschaft einmal betoniert wurde. Im wahrsten Sinne. Nicht perfekt, aber menschlich. Nicht glamourös, aber grundlegend.
Es ist auch eine Erinnerung daran, wie sehr sich das Verhältnis zum Bauen verändert hat. Wo früher Spaten in die Hand genommen wurden, regieren heute Ausschreibungen, Fördertöpfe, Verfahrensfragen. Wo früher drei Männer und ein Nachmittag reichten, braucht es heute Planungsphasen, Prüfstatik, Verfahrensakten. Das ist kein Vorwurf, sondern eine Beobachtung. Die Frage ist: Was geht dabei verloren – und was gewinnen wir an Sicherheit, Qualität, Gerechtigkeit?
Vielleicht ist es diese Brücke, die uns wieder daran erinnert, dass auch kleine Übergänge große Bedeutung haben. Und dass ihre wahre Tragkraft nicht nur aus Stahlbeton besteht – sondern aus dem Willen, Dinge gemeinsam zu schaffen.
↑ Zurück zum Seitenanfang Kapitel 2
Die Brücke über den Ibitzbach – Mehr als ein Bauwerk
Fragen und Antworten – Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz
↑ Zurück zum Seitenanfang Kapitel 2
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)