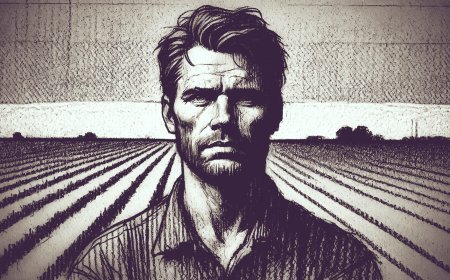Die Influencer-Falle: Kennzeichnungspflichten bei unbezahlter Unterstützung
Was ist Meinung, was ist politische Kommunikation? Dieses Dossier erklärt die neue EU-Kennzeichnungspflicht für unbezahlte politische Inhalte – verständlich, praxisnah, für Creator:innen, NGOs und Plattformen.
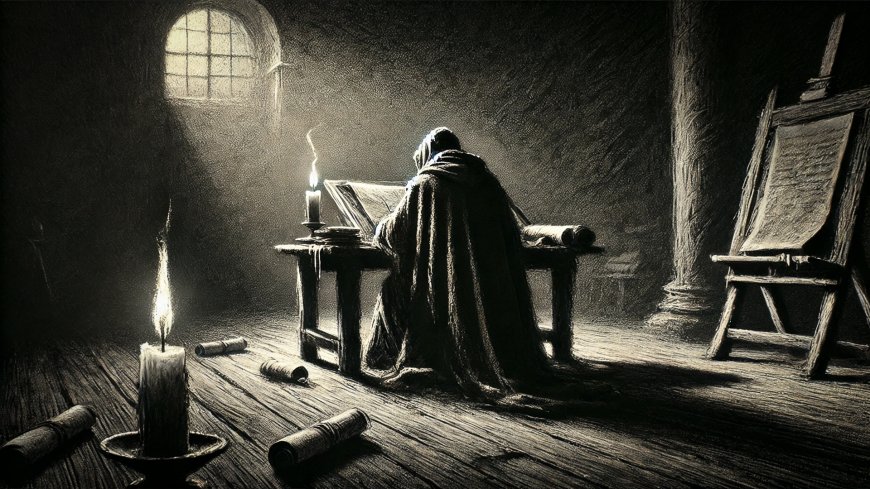
Kapitel 3: Begriffe und Abgrenzungen
Lesedauer: ca. 7 Minuten
Meinung ist frei – aber nicht immer kennzeichnungsfrei. Dieses Kapitel nimmt Begriffe wie „politische Kommunikation“, „Unterstützung“ und „Wirkung“ unter die Lupe. Mit klaren Beispielen und Kriterien: Wann ein Post noch privat ist – und wann er als politische Einflussnahme gilt.
3.1 Was ist „politische Kommunikation“?
Die TTPW-Verordnung führt den Begriff der politischen Kommunikation weitreichender ein, als bisherige gesetzliche Definitionen es getan haben.
Grundsätzlich gilt: Jede Mitteilung, die darauf abzielt, politische Meinungen zu beeinflussen oder politische Entscheidungen zu fördern, kann als politische Kommunikation gelten – ganz unabhängig davon, ob sie bezahlt wurde oder nicht.
Konkret bedeutet das: Auch ein Repost einer Parteiaussage auf Instagram, eine Story mit einer Wahlempfehlung oder ein Video, das sich positioniert zu einem Gesetzesvorschlag – all das fällt potenziell unter den Begriff der politischen Kommunikation.
Es kommt nicht mehr nur darauf an, wer etwas sagt, sondern wie und mit welcher Wirkung es geschieht.
Diese weite Auslegung ist ein bewusster Schritt, um den Realitäten digitaler Kommunikation gerecht zu werden.
Denn politische Meinungsbildung geschieht heute oft über soziale Medien, Alltagsbilder, Kommentare und Empfehlungen von Personen des öffentlichen Lebens – nicht mehr nur über Wahlprogramme oder politische Debatten.
3.2 Was gilt als „Unterstützung“ – auch ohne Geld?
Ein wesentlicher Aspekt der TTPW-VO ist: Es braucht keine Gegenleistung in Form von Geld oder Sponsoring, damit ein Beitrag als politisch relevant gilt.
Ideelle Motivation genügt – wenn der Inhalt objektiv geeignet ist, politische Wirkung zu entfalten.
Abgrenzungskriterien:
- Intention des Posts: Steht der Beitrag vorwiegend der Information oder der politischen Mobilisierung nahe?
- Sichtbarkeit und algorithmische Verstärkung: Wird der Beitrag algorithmisch bevorzugt ausgespielt? Erzielt er hohe Interaktion?
- Wiederholungscharakter und Reichweite: Ist es ein einmaliger Post – oder kommuniziert der Account regelmäßig politische Inhalte?
Diese Kriterien helfen Plattformen, Behörden und auch den Urheber:innen selbst einzuschätzen, ob eine Kennzeichnung notwendig ist. Denn oft liegt der Unterschied zwischen Meinung und Einflussnahme nicht im Inhalt selbst, sondern im Kontext.
3.3 Abgrenzung zur privaten Meinungsäußerung
Nicht jede politische Meinung muss gekennzeichnet werden. Die Herausforderung liegt darin, die Grenze zwischen privater Meinungsäußerung und kennzeichnungspflichtiger Kommunikation zu erkennen.
Kriterien, wann eine Äußerung „kippt“:
- Reichweite und Followerzahl: Ein privater Post an wenige Freunde ist weniger einflussreich als ein öffentlicher Beitrag an Zehntausende.
- Frequenz: Wer regelmäßig politische Inhalte teilt, bewegt sich eher im Bereich systematischer Einflussnahme.
- Tonalität und Mobilisierung: Ein neutraler Hinweis („Am Sonntag ist Wahl“) ist weniger kennzeichnungspflichtig als ein direkter Appell („Geht wählen – aber bitte nur Partei XY!“).
Beispiele:
- Privat: Eine Nutzerin teilt einen Zeitungsartikel zur Wahl und kommentiert ihn mit: „Interessant, was da steht.“
- Kennzeichnungspflichtig: Dieselbe Nutzerin ruft in ihrer Story explizit dazu auf, eine bestimmte Partei zu wählen – mit hoher Reichweite und wiederkehrender politischer Positionierung.
Es gilt: Je mehr ein Beitrag geeignet ist, Entscheidungen politisch zu beeinflussen, desto wahrscheinlicher wird er kennzeichnungspflichtig – unabhängig von der ursprünglichen Intention.
3.4 Pflicht zur Kennzeichnung – wie muss das aussehen?
Die TTPW-VO gibt klare Empfehlungen, wie die Kennzeichnung zu erfolgen hat.
Als Beispiel nennt sie die Formulierung:
„Dieser Beitrag enthält politische Kommunikation im Sinne von Art. 3 TTPW-VO.“
Pflicht zur Sichtbarkeit: Die Kennzeichnung muss direkt am Inhalt erfolgen – also nicht versteckt im Impressum, im Profiltext oder nur in einem Hashtag ganz am Ende.
Sie soll für Nutzer:innen unmittelbar erkennbar sein.
Das gilt auch für flüchtige Formate wie Stories oder Reels:
- Einblendung im Bild (Textoverlay)
- Gesprochener Hinweis im Video
- Deutlicher Hashtag wie #PolitischerBeitrag oder #PolitikPost
Die Praxis zeigt: Je kürzer die Aufmerksamkeitsspanne der Formate, desto prägnanter muss die Kennzeichnung sein.
Eine transparente Kommunikation stärkt nicht nur das Vertrauen, sondern schützt auch Creator:innen selbst vor rechtlichen Fallstricken.
Fazit Kapitel 3:
Die TTPW-VO schafft Klarheit, wo bisher Unsicherheit herrschte.
Sie unterscheidet nicht nach Intention, sondern nach Wirkung.
Wer politisch kommuniziert – egal ob aus Überzeugung, im Auftrag oder aus Eigeninitiative – soll das sichtbar machen.
Und wer sich im Zweifel befindet, ist gut beraten, lieber klar zu kennzeichnen als sich auf Ausreden zu verlassen.
Denn Transparenz ist kein Hindernis für Meinungsfreiheit – sie ist ihre Voraussetzung.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)