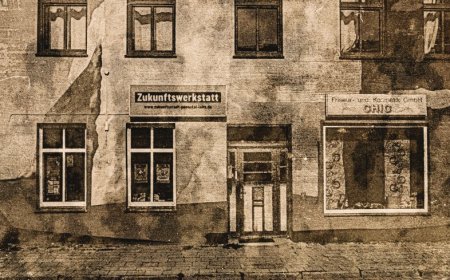Die Influencer-Falle: Kennzeichnungspflichten bei unbezahlter Unterstützung
Was ist Meinung, was ist politische Kommunikation? Dieses Dossier erklärt die neue EU-Kennzeichnungspflicht für unbezahlte politische Inhalte – verständlich, praxisnah, für Creator:innen, NGOs und Plattformen.
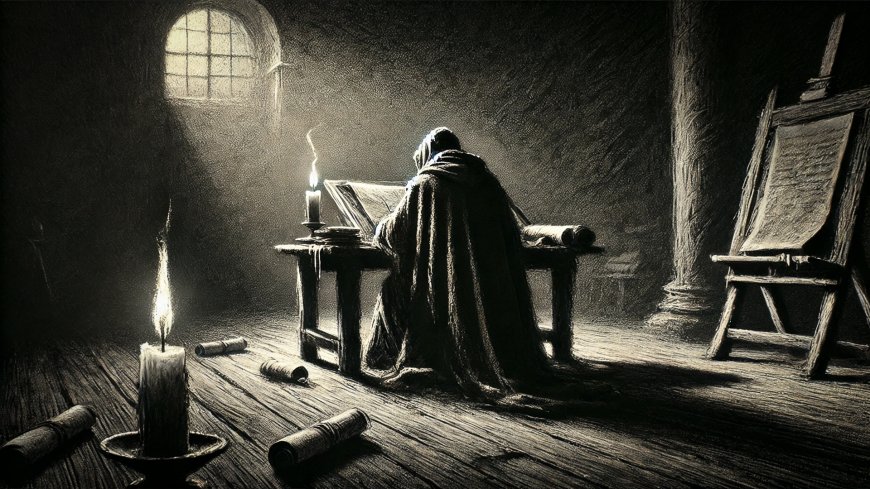
Kapitel 2: Rechtlicher Rahmen und Adressaten der Transparenzpflicht
Lesedauer: ca. 6 Minuten
Transparenz wird Pflicht. Und sie trifft nicht nur Parteien oder Werbeagenturen – sondern auch Influencer:innen, NGOs und Mikro-Accounts. Dieses Kapitel erklärt, warum die politische Wirkung nicht erst mit Geld beginnt und wer alles unter die neue EU-Verordnung fällt.
2.1 Ziel und Geltungsbereich – Warum es auf Transparenz jetzt ankommt
Mit der Verordnung (EU) 2024/900 zur Transparenz politischer Werbung verfolgt die Europäische Union ein klares Ziel: Sie will die demokratische Willensbildung im digitalen Raum absichern – durch mehr Nachvollziehbarkeit.
In einer Zeit, in der politische Botschaften innerhalb von Sekunden millionenfach verbreitet werden können – oft ohne erkennbare Absender oder klare Interessenlage –, wird Transparenz zum Schutzmechanismus. Und zwar nicht nur gegenüber gezielter Desinformation oder manipulativem Targeting, sondern auch gegenüber gut gemeinten, aber undurchsichtigen Formen der Einflussnahme.
Im Zentrum dieses Regelwerks steht Artikel 3 Absatz 1 – und dieser formuliert etwas, das eigentlich selbstverständlich klingt, bisher aber nur in Teilen gesetzlich verankert war: Wer politische Werbung veröffentlicht oder weiterverbreitet, muss sie auch als solche kenntlich machen.
Ganz konkret: Sobald jemand Inhalte teilt, die darauf abzielen, politische Meinungen zu formen, Wahlen zu beeinflussen oder bestimmte politische Haltungen zu fördern, ist dies künftig kein rein privater Akt mehr – sondern ein kennzeichnungspflichtiger Vorgang.
Das Besondere daran ist nicht nur die Verpflichtung selbst, sondern ihr breiter Anwendungsbereich. Denn der Begriff „politische Werbung“ wird bewusst weit gefasst – er umfasst nicht nur klassische, bezahlte Wahlwerbung oder Parteianzeigen.
Auch Inhalte, die „unterstützend“ oder ideell motiviert sind, fallen darunter. Also etwa ein Instagram-Post, in dem eine bekannte Person zu mehr Wahlbeteiligung aufruft. Oder ein TikTok-Video, das sich kritisch mit einer Gesetzesinitiative auseinandersetzt.
Sobald die Intention oder Wirkung des Inhalts in den Bereich politischer Einflussnahme fällt, greift die Kennzeichnungspflicht.
Ein Beispiel zur Verdeutlichung: Wenn eine Influencerin in ihrer Story schreibt: „Hey Leute, nicht vergessen – am Sonntag ist Wahl!“, wirkt das auf den ersten Blick harmlos. Aber wenn sie gleichzeitig betont, welche Partei aus ihrer Sicht „die einzig wählbare“ sei, ist die Grenze zur politischen Werbung schnell überschritten.
Ab diesem Moment verlangt die Verordnung, dass klar und für alle sichtbar gekennzeichnet wird: „Dieser Beitrag enthält politische Kommunikation im Sinne von Art. 3 TTPW-VO.“
Dabei ist der Grundgedanke kein Misstrauen gegenüber dem Einzelnen, sondern die Stärkung des gesellschaftlichen Vertrauens.
Denn politische Botschaften wirken anders als Produktwerbung: Sie greifen in Überzeugungen ein, in unser Bild von Gesellschaft, von Gerechtigkeit, von Zukunft.
Art. 3 Abs. 1 will also keine Meinung verbieten. Er will sie sichtbar machen – als das, was sie ist: Teil eines politischen Diskurses, der für alle nachvollziehbar bleiben muss.
Die Kennzeichnungspflicht ist damit keine bloße Formalie, sondern Ausdruck eines neuen demokratischen Bewusstseins für den digitalen Raum. Wer Einfluss nimmt, übernimmt Verantwortung. Und wer Verantwortung übernimmt, muss offenlegen, in welchem Rahmen er oder sie spricht.
2.2 Adressatenkreis – Wer ist betroffen?
Die Transparenzpflicht trifft nicht nur politische Parteien oder große Werbeagenturen – sie gilt für eine Vielzahl von Akteuren, die Inhalte erstellen, teilen oder verbreiten, die politisch wirken können.
Zunächst sind es natürlich die Influencer:innen, Creator:innen und Plattformbetreiber, die Inhalte öffentlich posten und Reichweiten generieren.
Wer etwa regelmäßig politische Themen aufgreift, sich positioniert oder zur Wahl aufruft, fällt potenziell unter die Regelung – ganz gleich, ob dies aus Überzeugung oder im Rahmen einer Kooperation geschieht.
Aber auch politische Parteien, NGOs, Bürgerinitiativen oder Agenturen, die Inhalte entwickeln oder verbreiten, stehen im Fokus. Selbst wenn sie kein Geld investieren, sondern auf organisches Wachstum und persönliche Überzeugung setzen, können ihre Beiträge politisch wirksam sein – und damit kennzeichnungspflichtig.
Besonders relevant wird das Thema für sogenannte Mikro-Influencer:innen und regionale Meinungsmultiplikator:innen.
Denn die TTPW-VO setzt keine hohen Schwellenwerte für Reichweite. Auch kleinere Accounts, die in ihrer Nische oder Region stark wirken, können betroffen sein – wenn ihre Inhalte geeignet sind, politische Entscheidungen zu beeinflussen.
Der entscheidende Maßstab bleibt immer die Wirkung: Nicht die Absicht oder Größe des Accounts, sondern die objektive Eignung zur politischen Einflussnahme.
2.3 Politische Kommunikation – weiter gedacht (Art. 3 Abs. 2 TTPW-VO)
Während Art. 3 Abs. 1 die grundsätzliche Kennzeichnungspflicht formuliert, legt Absatz 2 die Basis dafür, was überhaupt als „politische Kommunikation“ gilt – und hier zeigt sich der eigentliche Innovationscharakter der Verordnung.
Denn anstatt sich auf klassische, eindeutig bezahlte Werbung zu beschränken, öffnet der Gesetzgeber den Blick:
Politische Kommunikation kann viele Formen annehmen – und ist nicht zwangsläufig mit einem Geldfluss verbunden.
Als politische Kommunikation gilt jede Mitteilung – egal ob schriftlich, visuell oder audiovisuell –, die geeignet ist, politische Meinungen zu beeinflussen oder politische Prozesse zu fördern, unabhängig davon, ob sie bezahlt, gesponsert oder ideell motiviert ist.
Auch Inhalte, die aus persönlicher Überzeugung gepostet werden, können darunter fallen – wenn sie objektiv eine politische Wirkung entfalten.
Das ist gesellschaftlich notwendig: Denn politische Beeinflussung findet längst nicht mehr nur im formellen Raum statt. Sie lebt von Nähe, Ansprache im Alltag und Authentizität.
Genau deshalb sind Inhalte, die „aus dem Herzen“ kommen, nicht automatisch unproblematisch – im Gegenteil: Ihre Echtheit macht sie besonders wirksam.
2.4 Auch eigene Inhalte zählen (Art. 3 Abs. 4 TTPW-VO)
Ein besonders feiner, aber entscheidender Punkt: Die Transparenzpflicht gilt nicht nur für Inhalte, die im Auftrag Dritter verbreitet werden – sondern ausdrücklich auch für eigene Inhalte.
Also Beiträge, die ein Nutzer selbst erstellt und öffentlich verbreitet – vorausgesetzt, sie sind objektiv geeignet, politische Entscheidungen zu beeinflussen.
Dabei ist nicht die Absicht ausschlaggebend, sondern die Wirkung: Ein Story-Post ohne jede Kooperation, aber mit klarer Wahlempfehlung und hoher Reichweite, kann ebenso kennzeichnungspflichtig sein wie eine gesponserte Kampagne.
Das zeigt: Die TTPW-VO zieht eine neue Linie im digitalen Raum. Nicht, um Meinungen zu zensieren – sondern um sie einzuordnen.
Wer wirkt, soll auch sichtbar machen, dass er oder sie wirkt. Und damit einen Beitrag zu einem offenen, demokratischen Diskurs leisten.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)