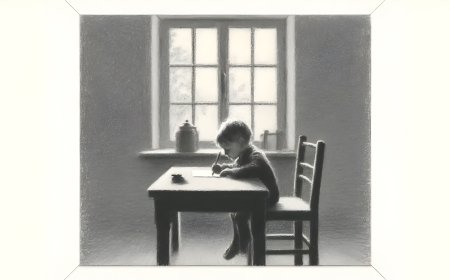Die Influencer-Falle: Kennzeichnungspflichten bei unbezahlter Unterstützung
Was ist Meinung, was ist politische Kommunikation? Dieses Dossier erklärt die neue EU-Kennzeichnungspflicht für unbezahlte politische Inhalte – verständlich, praxisnah, für Creator:innen, NGOs und Plattformen.
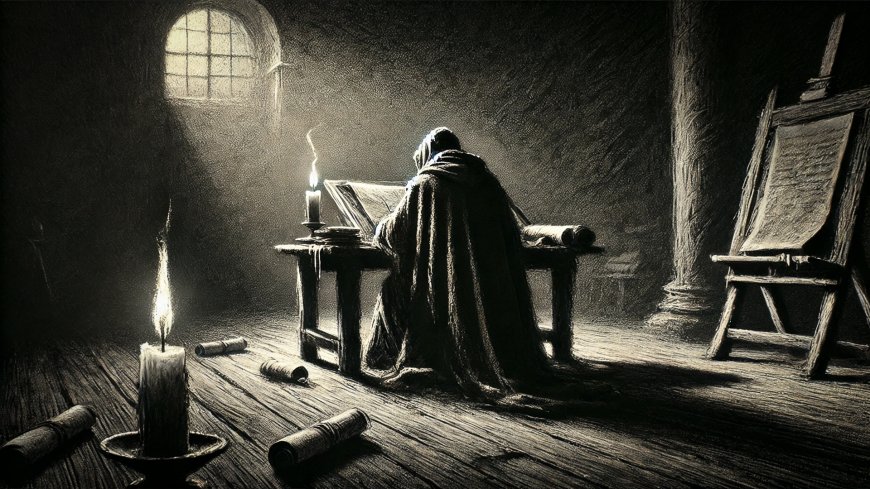
Kapitel 1: Wandel der politischen Kommunikation im digitalen Zeitalter
Lesedauer: ca. 4 Minuten
Von der Laternenstange ins Livestream-Studio – wie politische Meinungen heute nicht mehr über Wahlplakate entstehen, sondern zwischen Storys, Reels und Kommentaren. Dieses Kapitel zeigt, warum ein einzelner Post mehr bewirken kann als eine ganze Pressekonferenz – und weshalb das auch rechtlich neue Fragen aufwirft.
1.1 Zwischen Likes und Wahlempfehlungen – Wie das Netz politische Realität formt
Man muss kein Medienwissenschaftler sein, um zu bemerken: Die Art und Weise, wie wir heute über Politik sprechen, diskutieren – und unsere Meinungen dazu formen –, hat sich grundlegend verändert. Es sind längst nicht mehr nur klassische Nachrichtenformate oder Wahlplakate am Laternenmast, die unser politisches Bewusstsein prägen.
Vielmehr hat sich ein neues, dynamisches Ökosystem herausgebildet – ein Raum, der stark von Social Media und insbesondere von sogenannten Influencer:innen geprägt ist.
Diese Menschen, oft ohne journalistische Ausbildung oder formale politische Rolle, erreichen mit einem einzigen Story-Post mehr Menschen als manche Lokalzeitung in einem Monat. Was hier sichtbar wird, ist ein tiefgreifender Wandel der Kommunikationsrealität: Politische Meinungsbildung findet heute zu einem großen Teil innerhalb dieser Influencer-Ökosysteme statt.
Ob auf Instagram, TikTok oder YouTube – wer dort seine Reichweite nutzt, um etwa zur Wahl aufzurufen, sich mit bestimmten Parteien zu solidarisieren oder politische Themen zu setzen, nimmt Einfluss.
Das muss nicht einmal im klassischen Sinne bezahlt sein. Es reicht oft schon ein ideell motivierter Post – ein Aufruf, ein Statement, eine persönliche Meinung, die geteilt wird – und plötzlich steht man im Zentrum eines öffentlichen Diskurses.
1.2 Verschwimmende Grenzen – Von privater Meinung zur öffentlichen Einflussnahme
Genau hier beginnt das Problem. Denn die Grenze zwischen privater Meinung und öffentlicher Einflussnahme ist in digitalen Räumen nicht mehr so klar gezogen wie früher.
Was als spontane Story beginnt, kann sich binnen Stunden zu einem viralen Beitrag entwickeln – mit politischer Wirkung. Die Urheberin oder der Urheber mag überzeugt sein, einfach nur „aus dem Herzen“ zu sprechen. Doch für Follower entsteht ein Meinungsimpuls – ein Orientierungspunkt –, der genauso wahlentscheidend sein kann wie eine klassische Anzeige.
1.3 Von der Grauzone zur Regel: Politische Kommunikation braucht Transparenz
Was also tun mit dieser Grauzone? Wie geht man damit um, wenn politische Kommunikation nicht mehr über bezahlte Werbeplätze läuft, sondern sich in persönlichen Kanälen mit freundlichem Ton, Alltagsbildern und emotionalen Botschaften einnistet?
Bisher fehlte es hier an verbindlichen Regeln. Doch mit der neuen Transparenzverordnung der EU – konkret: Art. 3 der Verordnung (EU) 2024/900 zur Transparenz politischer Werbung (TTPW-VO) – wird erstmals eine Linie gezogen.
Eine klare, verbindliche Linie: Auch nichtkommerzielle politische Kommunikation – also solche ohne Bezahlung, aber mit politischer Wirkung – unterliegt künftig einer Kennzeichnungspflicht.
Das ist ein Paradigmenwechsel. Denn bislang waren Kennzeichnungspflichten hauptsächlich im kommerziellen Kontext verankert: Wenn jemand für ein Produkt warb, musste dies offengelegt werden – logisch. Doch politisch motivierte Posts, selbst wenn sie ohne Geldfluss entstanden, blieben oft im Nebel.
Die neue Regelung erkennt nun an: Auch „ideell motivierte Unterstützung“ politischer Inhalte ist einflussreich – und trägt Verantwortung.
Art. 3 der TTPW-VO schafft erstmals eine EU-weite Transparenzpflicht auch für nichtkommerzielle politische Kommunikation.
Das heißt: Nicht ob Geld geflossen ist, sondern ob ein Post geeignet ist, Meinungen zu beeinflussen, ist künftig entscheidend. Der Blick richtet sich also weg vom Motiv – hin zur Wirkung.
1.4 Keine Einschränkung – sondern Stärkung demokratischer Öffentlichkeit
Diese Neuregelung ist keine Einschränkung der Meinungsfreiheit – im Gegenteil: Sie soll helfen, Vertrauen in digitale politische Kommunikation zu stärken.
Wer mit offenen Karten spielt, wirkt glaubwürdiger. Die neue Transparenzpflicht bietet einen Rahmen, in dem sich freie Meinungsäußerung und gesellschaftliche Verantwortung nicht ausschließen, sondern ergänzen.
1.5 Abschlussgedanke
In einer Zeit, in der jeder mit einem Smartphone potenziell politischer Akteur oder Akteurin wird, braucht es nicht weniger, sondern mehr Klarheit darüber, was Meinung ist – und was Einflussnahme.
Der Wandel der Kommunikation verlangt nach neuen Regeln.
Art. 3 TTPW-VO ist ein erster, mutiger Schritt in diese Richtung.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)