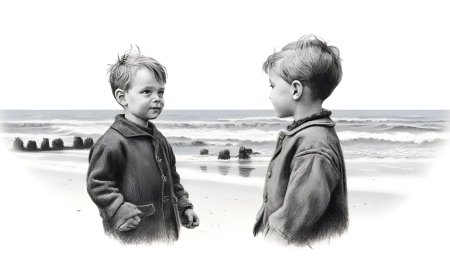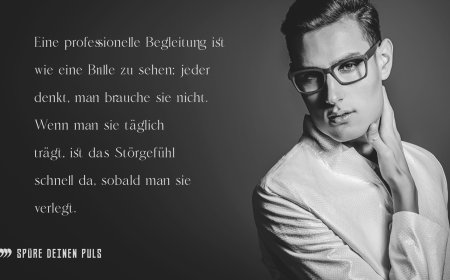ESF+ in Mecklenburg-Vorpommern: Das Ende der Sackgasse
Der Beitrag analysiert die ESF+-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern 2021–2027. Er beleuchtet Erfolge, Risiken und Förderlücken – und zeigt, wie sich MV auf die EU-Förderperiode 2028–2034 vorbereiten kann. Mit konkreten Empfehlungen für Politik und Praxis.
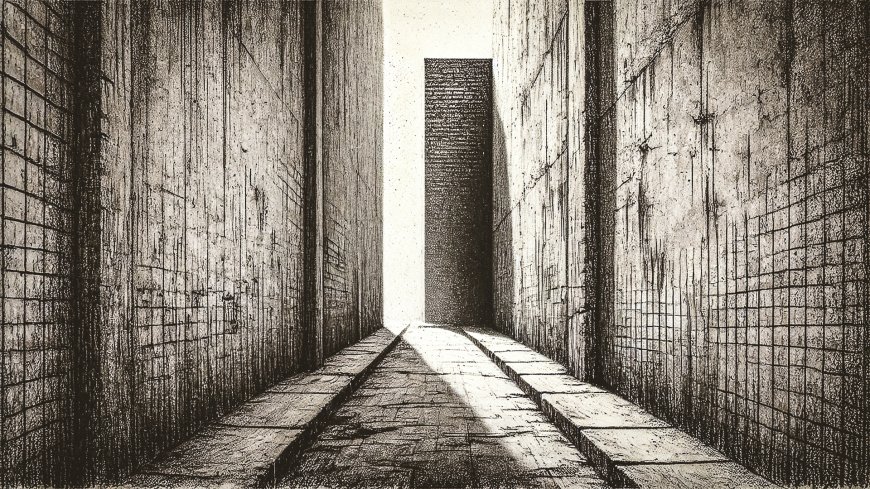
Kapitel 4: Nach vorn denken: Perspektiven für die EU-Förderperiode 2028–2034
Direkt springen: Start · Kapitel 1–5 · Disclaimer
Die nächste EU-Förderperiode rückt näher. Dieses Kapitel blickt voraus: Welche Themen stehen künftig im Fokus? Welche Chancen eröffnen sich für MV? Und welche Empfehlungen helfen, ab 2028 resilienter, digitaler und inklusiver zu fördern?
4.1 Neue Themen, neue Förderlogik
Blickt man voraus auf das Jahr 2028, dann ist eines bereits jetzt deutlich: Die neue EU-Förderperiode wird kein bloßes „Weiter so“. Vielmehr kündigt sich ein spürbarer thematischer Wandel an – mit neuen Prioritäten, veränderten Förderlogiken und frischen Chancen. Für Mecklenburg-Vorpommern bedeutet das: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um sich strategisch neu auszurichten.
Die neuen Schwerpunkte zeichnen sich bereits deutlich ab. Im Zentrum stehen drei große europäische Querschnittsthemen, die längst keine Vision mehr sind, sondern drängende Realität:
- Digitalisierung – nicht mehr nur als technisches Upgrade, sondern als Grundvoraussetzung für gesellschaftliche Teilhabe, wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und Bildungszugang.
- Klimaschutz – als verbindlicher Rahmen, der alle Projekte durchdringen wird: von grüner Qualifizierung über nachhaltiges Bauen bis hin zur CO₂-neutralen Verwaltung.
- Inklusion – weiterhin als sozialpolitischer Kernauftrag, aber stärker verknüpft mit Zukunftsthemen wie Barrierefreiheit in digitalen Räumen, inklusiver Green Economy oder chancengerechtem Zugang zu Technologie.
Was bedeutet das für die praktische Förderpolitik in MV?
Nach bisherigen Prognosen kann das Land auch in der kommenden Periode mit einem Fördervolumen zwischen 500 und 600 Millionen Euro rechnen – eine Größenordnung, die aufzeigt: MV bleibt förderpolitisch relevant. Doch die Verteilung wird sich verändern – nicht nur inhaltlich, sondern auch methodisch. Projekte müssen künftig noch klarer an europäische Strategien andocken, etwa an die Ziele des Green Deal oder an den Digital Europe Plan. Die Herausforderung wird sein, regionale Besonderheiten mit diesen großen Linien zu verbinden – und dabei die Menschen im Blick zu behalten, nicht nur die Technologien.
Ein zentrales Stichwort dabei: Qualifizierungsnetzwerke. Diese sollen in der neuen Förderperiode noch stärker unterstützt und ausgebaut werden. Denn der Arbeitsmarkt der Zukunft verlangt nicht nur punktuelle Weiterbildung, sondern vernetzte Lernlandschaften: zwischen Unternehmen, Bildungseinrichtungen, Trägern und Kommunen. Das Ziel: Wissen im Fluss halten – kontinuierlich, praxisnah, lebensphasenorientiert.
Denkbar sind hier etwa regionale Kompetenzzentren, die gemeinsam mit Hochschulen und Betrieben digitale Qualifikationen entwickeln – oder branchenspezifische Akademien, die ökologische Transformation mit konkreten Berufsbildern verbinden. Auch hybride Lernformate und Mikro-Zertifikate könnten gefördert werden – angepasst an Menschen, die neben Beruf, Familie und Alltag trotzdem weiterkommen wollen.
Schlussgedanke zum Abschnitt
Die neue Förderperiode wird kein Spaziergang – aber sie bietet echte Gestaltungschancen. Wer Digitalisierung, Klimaschutz und Inklusion nicht als Einzelthemen betrachtet, sondern als miteinander verknüpfte Zukunftsfelder, der kann Mecklenburg-Vorpommern als lernende, nachhaltige Region positionieren. Doch dafür braucht es jetzt Mut, Strategie – und den Willen, bekannte Wege zu verlassen.
4.2 Handlungsempfehlungen für Mecklenburg-Vorpommern
Der Blick nach vorn zeigt: Die nächste Förderperiode bringt nicht nur Chancen, sondern auch neue Anforderungen. Für Mecklenburg-Vorpommern wird es entscheidend sein, jetzt die richtigen Weichen zu stellen – nicht erst dann, wenn die neuen Programme starten, sondern jetzt, in der Phase der Vorbereitung.
Eine zentrale Empfehlung lautet deshalb: Vorsorge statt Nachsorge. Um künftig besser mit Unsicherheiten – wie etwa einem Förder-Gap – umgehen zu können, sollte das Land gezielt „Gap-Resilienz-Pläne“ entwickeln. Gemeint ist damit ein strategischer Puffer, bei dem mindestens 20 Prozent der Fördermittel oder entsprechenden Landesmittel als Reserve eingeplant werden. Nicht zum Zweck des Hortens, sondern um handlungsfähig zu bleiben, wenn EU-Mittel später als geplant fließen oder Förderlücken entstehen.
Gleichzeitig braucht es eine spürbare Vereinfachung der Zugänge – sowohl für Fördernehmende als auch für Beratungsstellen. Hier bietet sich die Einrichtung sogenannter One-Stop-Shops an: zentrale Anlaufstellen, an denen Förderinteressierte nicht mehr durch Formulardschungel und Zuständigkeitsfragen irren müssen, sondern alles aus einer Hand bekommen – Information, Antragshilfe, Feedback. Besonders kleinere Träger und Initiativen würden davon profitieren – sie, die oft gute Ideen haben, aber an der Struktur scheitern.
Ein dritter, nicht minder wichtiger Punkt ist die Rolle von MV auf europäischer Bühne. Wer in der kommenden Förderperiode nicht nur mitlaufen, sondern mitgestalten will, muss sich frühzeitig in die EU-Entscheidungsprozesse einbringen. Lobbyarbeit ist hier kein Schimpfwort, sondern ein legitimes und notwendiges Mittel, um regionale Interessen zu vertreten. Das bedeutet konkret: Präsenz in Brüssel, Teilnahme an Konsultationen, frühzeitige Rückmeldung zu Verordnungsentwürfen, Aufbau von strategischen Allianzen mit anderen strukturschwachen Regionen.
Schlussgedanke zum Abschnitt
Mecklenburg-Vorpommern hat in der laufenden Förderperiode viel erreicht – aber auch erlebt, wie verletzlich ein System wird, wenn zu spät reagiert wird. Die Empfehlungen für die Zeit ab 2028 sind deshalb mehr als eine To-do-Liste. Sie sind ein Appell: Jetzt planen, vorausschauen, mitgestalten. Denn wer heute vorbereitet ist, muss morgen nicht improvisieren.
ESF+ in Mecklenburg-Vorpommern – Das Ende der Sackgasse
Disclaimer & Transparenzhinweis
↑ Zurück zum Seitenanfang Kapitel 4
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)