ESF+ in Mecklenburg-Vorpommern: Das Ende der Sackgasse
Der Beitrag analysiert die ESF+-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern 2021–2027. Er beleuchtet Erfolge, Risiken und Förderlücken – und zeigt, wie sich MV auf die EU-Förderperiode 2028–2034 vorbereiten kann. Mit konkreten Empfehlungen für Politik und Praxis.
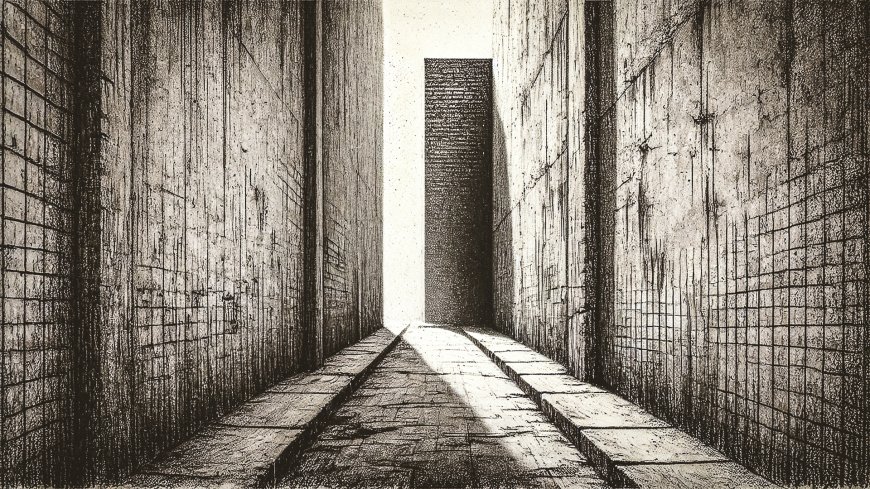
Kapitel 2: Zwischen Wirkung und Wirklichkeit – Die Förderjahre 2021–2025 im Rückblick
Direkt springen: Start · Kapitel 1–5 · Disclaimer
Von 2021 bis 2025 flossen Millionen aus dem ESF+ nach Mecklenburg-Vorpommern. Dieses Kapitel zeigt, wie die Mittel verteilt wurden, welche Programme besonders profitierten – und wo Erfolge, Lücken und Lehren für die Zukunft sichtbar werden.
2.1 Verteilung der Mittel
Wenn wir einen Moment innehalten und auf die vergangenen Jahre zurückblicken – auf die Zeit seit dem Start der ESF+-Förderperiode 2021 – dann lässt sich eines mit Gewissheit sagen: Die Mittel sind nicht nur geflossen, sie wurden auch mit Bedacht gelenkt. Denn Mittelverteilung ist mehr als das Ziehen von Linien in einem Budgetplan. Es ist ein politischer Kompass, der zeigt, welche Themen ein Land als dringlich betrachtet. In Mecklenburg-Vorpommern zeigt dieser Kompass sehr klar in Richtung Bildung, Teilhabe und soziale Sicherheit.
Etwa 40 Prozent aller bisher eingesetzten Gelder – das entspricht einem Löwenanteil – sind in Qualifizierungsmaßnahmen geflossen. Und das aus gutem Grund. In einem Land, in dem der Fachkräftemangel keine abstrakte Statistik ist, sondern eine spürbare Realität in Pflegeeinrichtungen, Werkhallen und Schulen, ist Weiterbildung mehr als nur ein Bildungsauftrag. Sie ist eine Überlebensstrategie für Wirtschaft und Gesellschaft. Ob es sich um Umschulungen handelt, um digitale Kompetenztrainings oder um arbeitsplatzbezogene Weiterbildung – überall dort, wo Menschen durch Wissen neue Wege betreten können, ist der ESF+ zur Stelle.
Weitere 30 Prozent der Mittel wurden für Maßnahmen zur sozialen Inklusion bereitgestellt. Das klingt vielleicht technisch, aber im Kern geht es hier um die Frage: Wie schaffen wir es, dass niemand zurückbleibt? Ob Menschen mit Behinderung, mit Migrationsgeschichte, mit psychischen Erkrankungen oder mit langen Erwerbslücken – diese Programme öffnen Türen, die sich sonst oft verschlossen halten. Inklusion ist dabei nicht bloß ein pädagogisches Ideal, sondern ein ökonomischer und sozialer Gewinn.
Die restlichen 20 Prozent der bisher verteilten Fördergelder flossen in die Armutsbekämpfung – in Projekte, die Menschen helfen sollen, stabile Lebensverhältnisse aufzubauen: mit Beratung, Unterstützung, strukturierten Übergängen aus Arbeitslosigkeit oder Abhängigkeit. Armut wird hier nicht als individuelles Versagen gesehen, sondern als gesamtgesellschaftliches Problem, das aktives Gegensteuern erfordert.
Diese Zahlen allein sagen natürlich noch nicht alles. Interessant wird es, wenn man sie in den räumlichen und wirtschaftlichen Kontext Mecklenburg-Vorpommerns einbettet. Die Förderstrategie folgt einem klaren Muster, das sich an den drei Wirtschafts- und Förderbereichen orientiert, die oft schlicht mit den Buchstaben A, B und C benannt werden.
Bereich A umfasst die Biotechnologie – mit einem deutlichen Schwerpunkt in Greifswald. Hier wurde gezielt in forschungsnahe Projekte investiert, etwa in die Kooperation mit Hochschulen oder in die Fortbildung technischer Fachkräfte. Ein Gebiet, das nicht nur Zukunftstechnologie verspricht, sondern bereits heute zur Innovationskraft der Region beiträgt.
Bereich B steht für die Logistik, insbesondere in der Region Rostock, wo Umschlag, Transport, maritime Wirtschaft und Digitalisierung Hand in Hand gehen. Auch hier hat der ESF+ unterstützt – nicht nur bei der Fachausbildung, sondern auch bei der Qualifizierung im Bereich nachhaltiger Mobilität und smarter Transportlösungen.
Bereich C, der dritte große Fokus, widmet sich dem Tourismus – mit einem besonderen Blick auf Inklusionsangebote. In einem Land wie MV, das vom Küsten- und Naturtourismus lebt, ist es nur konsequent, auch barrierefreie Angebote zu fördern. Das betrifft sowohl die bauliche Infrastruktur als auch die Schulung von Personal, damit der „Urlaub für alle“ nicht nur eine schöne Idee bleibt, sondern gelebte Realität wird.
Auch bei der regionalen Verteilung zeigt sich ein durchdachtes Bild. Während in Vorpommern – beispielsweise in Greifswald oder Anklam – verstärkt in kleinteilige, forschungsnahe Projekte investiert wurde, lag in West-MV, etwa rund um Schwerin oder Wismar, der Fokus eher auf großflächigen arbeitsmarktpolitischen Maßnahmen. Diese Balance ist kein Zufall, sondern das Ergebnis einer bewussten Strategie: Potenziale fördern, ohne dabei strukturell benachteiligte Regionen zurückzulassen.
Insgesamt wurden bis zum Jahr 2025 rund 222 Millionen Euro vergeben, was etwa 40 Prozent der insgesamt verfügbaren Mittel entspricht. Auf den ersten Blick könnte man sagen: Da ist noch Luft nach oben. Doch wenn man bedenkt, dass diese Jahre von Pandemie, Umbrüchen und großen Strukturfragen geprägt waren, dann ist dieser Wert alles andere als gering. Er steht für tausende Maßnahmen, Beratungsstunden, Kurswochen und Impulse – viele davon mit langfristiger Wirkung.
2.2 Erfolge, die zählen
Zahlen allein sind selten spannend – es sei denn, sie erzählen eine Geschichte. Und genau das tun die Ergebnisse der ESF+-Förderung in Mecklenburg-Vorpommern seit 2021. Denn hinter jeder Zahl, die hier auftaucht, steht ein Mensch. Oder sogar viele. Menschen, die einen Kurs besucht, einen Abschluss gemacht, eine neue Perspektive gefunden haben. Und wenn wir über mehr als 10.000 geschaffene Qualifizierungsplätze sprechen, dann reden wir nicht über Verwaltungseinträge, sondern über reale Lebenswege, die sich verändert haben.
Was bedeutet das konkret? Es bedeutet, dass in ganz MV Tausende Menschen – oft Erwachsene mit gebrochener Erwerbsbiografie – noch einmal neu anfangen konnten. In Kursräumen, Werkstätten, digitalen Lernplattformen, aber auch direkt am Arbeitsplatz. Von Pflegehilfskräften, die sich zur examinierten Pflegekraft weiterbilden ließen, bis hin zu Angestellten in kleinen Betrieben, die endlich die nötigen IT-Kenntnisse für den digitalen Wandel erwerben konnten – die Spannbreite der Programme war groß, und ihre Wirkung spürbar.
Besonders bemerkenswert ist der Fokus auf Frauen in MINT-Berufen – ein Bereich, in dem die Schieflage zwischen den Geschlechtern immer noch hartnäckig ist. Über 5.000 Frauen in Mecklenburg-Vorpommern konnten in der laufenden Förderperiode durch gezielte Maßnahmen den Einstieg in Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik schaffen. Und das nicht etwa als Einzelfall, sondern systematisch: durch gezielte Ansprache, Mentoringprogramme, praxisorientierte Workshops und Fördermodelle, die Rücksicht auf Pflegearbeit, Teilzeit-Verfügbarkeit und Vereinbarkeit mit Familie nehmen.
Gerade im ländlichen Raum – also da, wo es oft keine zweite Chance gibt – zeigen diese Programme Wirkung. Sie holen Menschen dort ab, wo sie stehen. Und sie führen sie dorthin, wo sie hinwollen. Ohne Stigma. Ohne bürokratische Hürden. Einfach durch konsequente Förderung mit Weitblick.
Ein besonders wichtiger Meilenstein war die Halbzeitbilanz im Jahr 2025. Trotz aller Unsicherheiten – Stichwort: Pandemie, Lockdowns, Fachkräftemangel – fiel sie deutlich positiv aus. Die Maßnahmen wurden nicht nur fortgesetzt, sondern vielerorts sogar ausgeweitet. Das ist keine Selbstverständlichkeit. Viele andere Regionen mussten in dieser Zeit Mittel zurückgeben oder Projekte auf Eis legen. In MV aber blieb der Motor an – manchmal ruckelnd, aber nie stillstehend.
Was diese Bilanz zusätzlich unterstreicht, sind die Fallstudien aus der Praxis. Da ist zum Beispiel das Mentoring-Programm für benachteiligte Jugendliche, das im Raum Neubrandenburg jungen Menschen den Übergang von der Schule in den Beruf erleichtert. Oder die berufsbegleitende Weiterbildung für Alleinerziehende in Ludwigslust, die in Modulen strukturiert ist – angepasst an familiäre Belastung und Alltag. Und da sind die Inklusionsprojekte in der Tourismusregion Rügen, wo Hotels barrierefrei umgebaut wurden, inklusive Schulungen für das Personal.
Diese Projekte wirken nicht nur nach innen, sondern auch nach außen: Sie verändern Bilder. Von dem, was möglich ist. Von dem, was „förderwürdig“ ist. Und nicht zuletzt von dem, was wir als Gesellschaft bereit sind zu tun, um Teilhabe zu ermöglichen – für alle.
Schlussgedanke zum Abschnitt
Es ist leicht, Förderpolitik auf Zahlen zu reduzieren. Aber die wahre Wirkung entfaltet sich dort, wo die Fördergelder auf Wirklichkeit treffen: im Schulungsraum, im Bewerbungstraining, im Gespräch zwischen Mentor und Mentee. Die Erfolge der ESF+-Periode 2021 bis 2025 in Mecklenburg-Vorpommern zeigen, dass solche Maßnahmen mehr sind als ein temporäres Pflaster. Sie sind Strukturarbeit an der Zukunft – konkret, nachhaltig und notwendig.
2.3 Stolpersteine und Strukturprobleme
Natürlich ist nicht alles glatt gelaufen. Wer sich ein ehrliches Bild machen will, muss auch dorthin schauen, wo Dinge ins Stocken geraten sind – oder schlicht nicht funktioniert haben. Und ja: Auch im Rahmen der ESF+-Förderperiode 2021 bis 2025 gab es in Mecklenburg-Vorpommern Herausforderungen, die nicht unter den Teppich gekehrt werden sollten. Im Gegenteil: Sie zeigen, wo es noch Luft nach oben gibt – und wo strukturelle Bremsen gelöst werden müssen, wenn Förderung wirklich flächendeckend wirken soll.
Ein ganz konkreter Befund: 10 bis 15 Prozent der Fördermittel blieben bislang ungenutzt. Das heißt: Gelder, die eigentlich für soziale Projekte, Qualifizierung und Inklusion vorgesehen waren, konnten nicht oder nur teilweise abgerufen werden. Das ist besonders bedauerlich, weil der Bedarf vorhanden war – und ist. Doch was hat zu dieser Lücke geführt?
Ein zentraler Faktor war – wie so oft in den letzten Jahren – die Corona-Pandemie. Sie hat Zeitpläne gesprengt, Projektstarts verzögert und Planbarkeit erschwert. Viele Träger standen 2021/22 vor der Wahl: Entweder weiterarbeiten unter völlig veränderten Bedingungen oder pausieren. Manche mussten Programme sogar ganz abbrechen – nicht, weil die Ideen schlecht waren, sondern weil schlicht die Rahmenbedingungen nicht mehr stimmten. Präsenzangebote wurden plötzlich unmöglich, digitale Alternativen waren nicht überall sofort einsatzbereit. Wer je versucht hat, ein Lernprogramm über Videokonferenz mit Menschen in prekären Lebenslagen durchzuführen, weiß: Es braucht mehr als nur eine stabile Internetverbindung.
Doch neben den pandemiebedingten Störungen zeigt sich noch ein zweiter, systemischer Bremsfaktor, der bis heute viele gute Ansätze ausbremst: bürokratische Hürden. Genauer gesagt: ein zu kompliziertes Antragsverfahren. Viele kleine Träger, Vereine oder Initiativen – genau die, die oft die kreativsten, lebensnahesten Projekte in ihren Gemeinden entwickeln – scheitern schon auf der ersten Etappe: am Formular, am Zeitrahmen, an den Nachweispflichten.
Was dabei entsteht, ist eine paradoxe Situation: Geld wäre da. Bedarf auch. Aber zwischen beiden Seiten steht eine Wand aus Regularien, Prüfroutinen und Unklarheiten. Das führt dazu, dass größere Träger – mit eigener Verwaltungsstruktur – leichter durchkommen, während kleine Organisationen außen vor bleiben. Das widerspricht dem eigentlichen Geist des ESF+, der ja gerade auch die Vielfalt und Nähe zur Lebensrealität fördern will.
Es ist daher kein Wunder, dass aus verschiedenen Richtungen – von Trägern, Kommunen, aber auch aus Ministerien – der Ruf nach einer Vereinfachung des Antragsverfahrens laut geworden ist. Weniger Papier, klarere Fristen, digitalisierte Prozesse und vor allem: eine bessere Begleitung für Erstbewerberinnen und -bewerber. Denn wer einmal durch den Prozess durch ist, weiß: Es geht. Aber es braucht Geduld, Fachwissen – und oft Hilfe von außen.
Schlussgedanke zum Abschnitt
Förderpolitik ist immer ein Balanceakt zwischen Kontrolle und Vertrauen. Zwischen Mittelvergabe und Mittelverwendung. Die Herausforderungen in Mecklenburg-Vorpommern zeigen, dass Vertrauen oft der bessere Hebel ist – besonders dann, wenn die Strukturen lokal, engagiert und wirksam sind. Wer mehr Menschen erreichen will, muss die Wege zu den Fördergeldern einfacher machen. Denn am Ende geht es nicht um Bürokratie – es geht um Wirkung. Und jede nicht genutzte Förderung ist eine verpasste Chance auf genau diese Wirkung.
ESF+ in Mecklenburg-Vorpommern – Das Ende der Sackgasse
Disclaimer & Transparenzhinweis
↑ Zurück zum Seitenanfang Kapitel 2
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)




























































