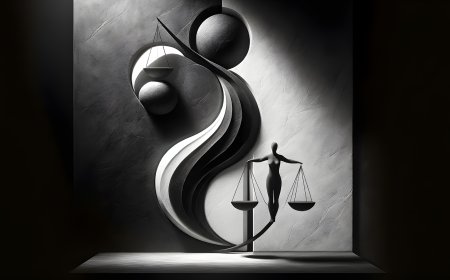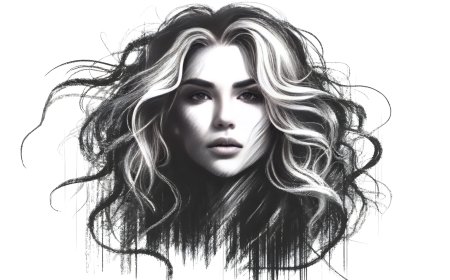Die Influencer-Falle: Kennzeichnungspflichten bei unbezahlter Unterstützung
Was ist Meinung, was ist politische Kommunikation? Dieses Dossier erklärt die neue EU-Kennzeichnungspflicht für unbezahlte politische Inhalte – verständlich, praxisnah, für Creator:innen, NGOs und Plattformen.
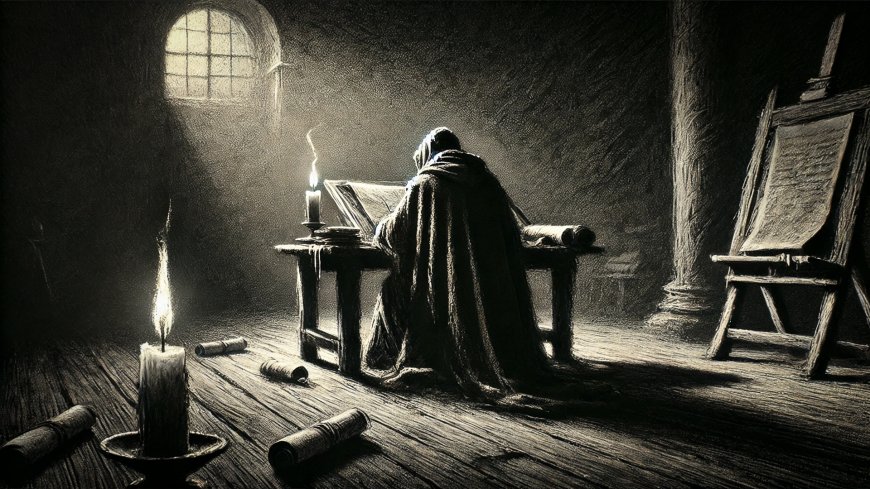
Kapitel 5: Konsequenzen für Praxis und Kommunikation
Lesedauer: ca. 6 Minuten
Posten mit Anstand – und Verstand. Dieses Kapitel gibt konkrete Orientierung für Creator:innen, NGOs, Agenturen und Plattformen. Wie man rechtssicher kennzeichnet, was es bei Kooperationen zu beachten gibt – und warum Transparenz nicht lähmt, sondern Vertrauen schafft.
5.1 Neue Verantwortung für Creator:innen und Influencer
Mit der Einführung der TTPW-Verordnung ändert sich das Rollenverständnis vieler digitaler Akteur:innen. Was bisher als rein private Meinungsäußerung galt, kann nun unter bestimmten Bedingungen als politische Kommunikation gewertet werden – und damit unter die Kennzeichnungspflicht fallen.
Vor allem Influencer:innen, Content-Creator und engagierte Nutzer:innen mit mittlerer oder hoher Reichweite müssen sich bewusst machen: Wer Sichtbarkeit hat, hat Wirkung – und damit Verantwortung.
Das betrifft nicht nur bezahlte Inhalte, sondern ausdrücklich auch solche, die aus Überzeugung gepostet werden.
Der entscheidende Schritt ist also ein Perspektivwechsel: Nicht die Absicht zählt, sondern die Wirkung.
Ob jemand politisch motiviert oder „nur“ solidarisch ist – sobald der Beitrag geeignet ist, Meinungen zu formen oder politische Entscheidungen zu beeinflussen, sollte dies offengelegt werden.
5.2 Agenturen, NGOs, Parteien – Mitverantwortung beim Teilen und Streuen
Nicht nur einzelne Creator:innen oder Influencer stehen unter Beobachtung. Auch politische Parteien, NGOs, Agenturen oder Bürgerbündnisse geraten zunehmend in den Fokus.
Wer Content mit politischer Aussagekraft in Umlauf bringt, sei es durch Kooperationen mit Netzakteur:innen oder über eigene Kanäle, trägt Mitverantwortung für die Einhaltung der Kennzeichnungspflicht.
Das betrifft nicht nur den Moment der Veröffentlichung, sondern beginnt bereits bei der Planung: Wenn etwa eine Organisation Materialien erstellt, klare Botschaften formuliert oder gezielt Multiplikator:innen anspricht, entsteht eine strukturelle Mitwirkung an der politischen Kommunikation – und damit auch eine rechtliche Mitverantwortung für Transparenz.
Um spätere Konflikte oder Bußgelder zu vermeiden, empfiehlt sich ein professioneller Umgang:
- Klare Briefings
- Schriftliche Vereinbarungen
- Vorab definierte Standards zur Kennzeichnung – besonders bei großen Reichweiten oder sensiblen Themen
Transparenz ist dabei nicht nur regulatorische Pflicht – sondern auch Zeichen von Professionalität.
Eine gute Kampagne denkt heute nicht nur in Zielgruppen, sondern auch in Verantwortung: Wer Wirkung entfaltet, sollte offenlegen, wie sie entsteht – und wer daran mitwirkt.
5.3 Plattformen als Schnittstelle – Moderation, Meldung, Meldesysteme
Wie bereits in Kapitel 4 erläutert, nehmen Plattformen eine Schlüsselrolle bei der Umsetzung der Verordnung ein.
Für die Praxis bedeutet das konkret:
- Plattformen müssen Hinweise auf politische Kommunikation maschinell und manuell überprüfen,
- Inhalte ggf. kennzeichnen, einschränken oder löschen,
- und zugleich sicherstellen, dass Meinungsfreiheit nicht unverhältnismäßig eingeschränkt wird.
Für Content-Ersteller:innen heißt das: Es kann passieren, dass ein Beitrag nachträglich von Plattformen als politisch eingestuft und markiert wird – oder dass Nutzer:innen zur Nachbesserung aufgefordert werden.
Wichtig: Wer sich ungerecht behandelt fühlt, hat Recht auf Widerspruch (z. B. nach Art. 17 DSA) und kann eine Beschwerde einlegen.
5.4 Empfehlungen für die Praxis – Transparenz strategisch denken
Damit aus der neuen Pflicht kein Stolperstein wird, sondern ein Gewinn an Glaubwürdigkeit, empfiehlt sich ein bewusster und proaktiver Umgang mit dem Thema.
Für Creator:innen:
- Eigene Inhalte regelmäßig reflektieren: Hat dieser Post politische Wirkung?
- Klare Formulierungen nutzen: z. B. „Dieser Beitrag enthält politische Kommunikation.“
- Sichtbare Platzierung im Content: im Bild, im Text, im gesprochenen Wort.
- Bei Unsicherheit lieber kennzeichnen als verstecken.
Für NGOs, Parteien, Agenturen:
- Inhalte vorab rechtlich und strategisch prüfen lassen.
- Kooperationen mit Influencer:innen vertraglich regeln (inkl. Kennzeichnung).
- Interne Guidelines zur TTPW-VO etablieren.
Für Plattformen:
- Transparente, nachvollziehbare Prozesse für Kennzeichnung und Moderation aufbauen.
- Schulungen und FAQs für Creator:innen anbieten.
- Beschwerden ernst nehmen – und differenzierte Prüfmechanismen schaffen, auch für unbezahlte Kommunikation.
5.5 Bin ich betroffen? – Orientierung statt Unsicherheit
Die TTPW-VO formuliert klare Anforderungen – aber viele Fragen stellen sich erst in der Anwendung.
Die folgende Übersicht bietet eine erste Orientierung:
| Frage | Antwort: Ja | Antwort: Nein | Hinweis |
|---|---|---|---|
| Hat der Post politischen Inhalt oder Bezug zu politischen Entscheidungen? | Prüfen | Keine Pflicht | z. B. Wahlaufruf, Gesetzesbezug, Parteiunterstützung |
| Geht es nur um persönliche Meinung oder um eine öffentliche Mobilisierung? | Prüfen | Keine Pflicht | Meinung ist geschützt – Wirkung entscheidet |
| Hat der Post eine relevante Reichweite (z. B. > 1.000 Follower)? | Mögliche Pflicht | Geringes Risiko | Keine harte Grenze, aber Reichweite + Sichtbarkeit zählen |
| Wird der Inhalt durch Dritte bereitgestellt, beauftragt oder empfohlen? | Kennzeichnung nötig | Eher privat | Auftrag, Kooperation oder Kampagnennähe = Pflichtfeld |
| Ist der Inhalt geeignet, politische Entscheidungen zu beeinflussen? | Pflicht zur Kennzeichnung | Prüfen | „Objektive Eignung zur Beeinflussung“ ist zentrales Kriterium |
| Wird auf Parteien, Kandidat:innen, Gesetzesvorhaben etc. Bezug genommen? | Höchstwahrscheinlich pflichtig | Unkritisch | Auch implizite Unterstützung zählt |
| Wurde bezahlt oder gesponsert? | Pflichtfeld | Ideelle Motivation prüfen | Auch unbezahlte Inhalte können pflichtig sein |
Hinweis: Diese Tabelle ersetzt keine Einzelfallprüfung. Entscheidend ist stets die objektive politische Wirkung – unabhängig von Absicht oder Bezahlung.
5.6 Chancen statt Hürden – Transparenz als Kultur der Verantwortung
So sehr neue Regelungen zunächst als Einschränkung erscheinen mögen – sie können auch ein Weg sein, Vertrauen in digitale Kommunikation zurückzugewinnen.
Wer offenlegt, woher politische Inhalte kommen, stärkt die Mündigkeit der Empfänger:innen.
Die TTPW-VO verleiht damit nicht nur juristische Schärfe, sondern setzt ein kulturelles Signal: Meinung bleibt frei. Aber sie ist kein Schutzschild gegen Verantwortung.
Wenn diese Haltung verinnerlicht wird – von Einzelpersonen, Organisationen und Plattformen gleichermaßen – kann aus einer Regulierung ein Mehrwert für die digitale Demokratie entstehen.
Fazit Kapitel 5:
Transparenz wird zur Währung der Glaubwürdigkeit.
Die TTPW-VO fordert kein Schweigen, sondern Sichtbarkeit.
Wer wirkt, steht sichtbar zu seiner Wirkung.
Und das ist nicht das Ende der freien Kommunikation – sondern ihr demokratisches Fundament.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)