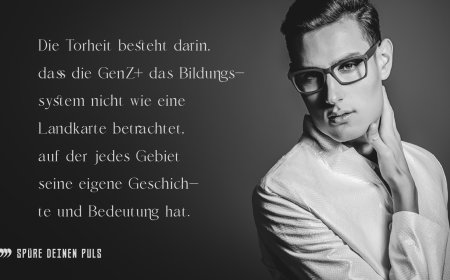Die Causa „Marktstraße“: Anatomie einer Inszenierung
„Marktstraße – Anatomie einer Inszenierung“ erzählt, wie sich ein lokales Gerücht in eine politische Realität verwandelt. Ein persönlicher, präziser Text über Sprache, Angst und Verantwortung – und die zerstörerische Macht populistischer Narrative.
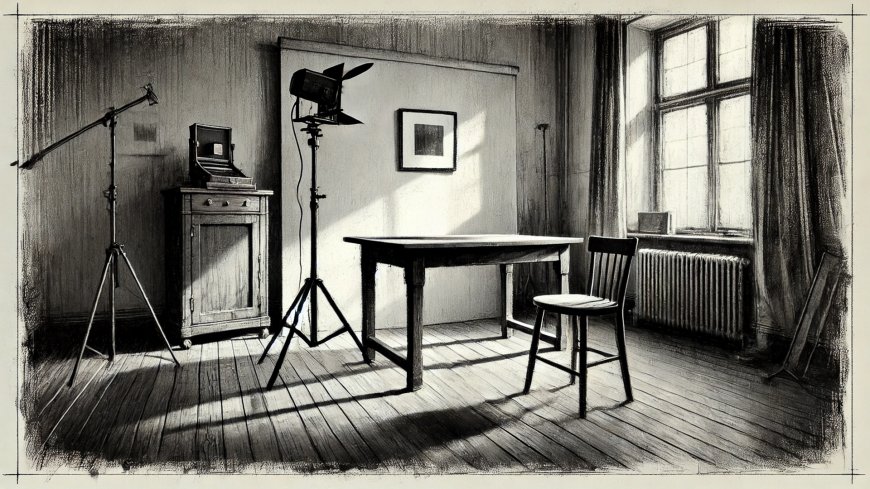
Die Inszenierung nach außen
Nachdem sich das Narrativ rund um die Marktstraße zunächst in einem kleinen, aufgeladenen Raum formte – zwischen angestrengten Blicken und unbelegten Behauptungen –, trat es bald hinaus aus diesem privaten Schatten. Und wie bei vielen Geschichten, die sich verselbständigen, wurde sie nicht nur weitererzählt, sondern bewusst verstärkt, zugespitzt, aufgeladen.
Zuerst waren es die Räume selbst, die ihr neues Gewicht verliehen. Die Wahl des Alten Amtsgerichts als Ort der Bürgersprechstunden war mehr als eine bloße Entscheidung der Logistik. Der Raum trug Geschichte, Autorität. Und wenn dort von Kontrollverlust und Bedrohung die Rede war, klang es nicht mehr wie subjektive Wahrnehmung – sondern wie ein ernstzunehmendes, öffentliches Anliegen.
Bürgermeisterin Christine Witt ließ diese Treffen zu, verwies öffentlich auf eine Überforderung der Kommune – allerdings ohne konkrete Vorfälle zu benennen. Ihr Schreiben wirkte wie ein Stempel, ein Quasi-Siegel städtischer Legitimität für eine Erzählung, die bislang auf vagen Eindrücken beruhte. Und genau dieser offizielle Ton machte sie plötzlich politisch verwertbar.
Diese Gelegenheit griff der AfD-Stadtvertreter Mario Kehrle auf. Er wechselte von der Rolle des Zuhörers zum Moderator – nicht vermittelnd, sondern verstärkend. Begriffe wie „Randale“, „Terrorisierung“ oder „rechtsfreier Raum“ waren keine nüchternen Beschreibungen, sondern bewusst gesetzte Reizworte.
Seine Strategie war klar: erst behaupten, dann wiederholen, dann zuspitzen. Keine Aufklärung, sondern Eskalation.
Es dauerte nicht lange, bis die Medien aufmerksam wurden. Erst regionale, dann überregionale – darunter der NDR – griffen das Thema auf. Und wie so oft, wenn Worte auf suggestive Bilder treffen, entstanden Schlagzeilen mit Sogkraft: „Problemstraße im Nordosten“ oder „Loitz – ein Ort am Limit“.
Dazu Bilder von Polizeiautos, Hausfassaden im Abendlicht, leere Spielplätze, ein umgekippter Mülleimer – visuelle Bestätigung einer Bedrohung, unabhängig von ihrer faktischen Grundlage. Für Außenstehende entstand so eine mediale Realität, die stimmig wirkte. Und was stimmig wirkt, wird selten hinterfragt.
Der eigentliche Höhepunkt aber spielte sich dort ab, wo Narrative endgültig politisch werden: im Landtag von Mecklenburg-Vorpommern.
Am 15. Mai 2025 brachte der AfD-Abgeordnete Enrico Schult die Marktstraße in die Landespolitik. Er konfrontierte Innenminister Christian Pegel mit den Vorwürfen aus dem Brief der Bürgermeisterin.
Doch statt der Erzählung mit belegbaren Fakten zu begegnen – etwa durch Hinweise auf fehlende Anzeigen oder laufende Ermittlungen – sprach Pegel von „Klingelstreichen“ und versuchte, das Thema abzuschwächen.
Was sachlich legitim war, wirkte kommunikativ schwach – fast hilflos angesichts der emotionalen Bilder, die längst im Umlauf waren.
In der zweiten Debatte, am 9. Oktober 2025, eskalierte Schult die Situation. Er verwies auf zwei Brandanschläge, die inzwischen tatsächlich stattgefunden hatten – und stellte sie in direkten Zusammenhang mit seiner vorherigen Warnung.
Damit schien das Narrativ nachträglich bestätigt – obwohl die Hintergründe der Taten ganz andere waren.
Pegel reagierte emotional, warf der AfD „Hetze und Spaltung“ vor, verweigerte aber weitere Angaben unter Verweis auf laufende Ermittlungen.
Aus juristischer Sicht korrekt – aus rhetorischer Sicht erneut ein Vakuum. Die Deutungshoheit blieb bei jenen, die lauter behaupteten.
Am Ende war es fast nebensächlich, was in der Marktstraße tatsächlich geschehen war – oder nicht. Die Geschichte hatte sich längst von der Wirklichkeit gelöst. Sie war zum Symbol geworden.
Für viele stand die Marktstraße nun nicht mehr für eine Adresse in Loitz – sondern für ein Gefühl: Das Gefühl, dass der Staat nicht mehr schützt, dass Regeln nichts mehr gelten, dass Ordnung brüchig geworden ist.
Das ist die eigentliche Kraft solcher Erzählungen: Sie müssen nicht wahr sein – sie müssen nur glaubwürdig wirken. Und wenn sie oft genug wiederholt, bebildert und politisch verwertet werden, dann entstehen Muster. Aus einem Ort wird ein Mythos. Aus Unsicherheit wird eine Wahrheit – oder das, was man dafür hält.
Denn genau dort liegt die Gefahr: Je öfter ein Bild gezeigt wird, desto schwerer fällt es, dahinterzublicken. Gefühl wird zur Tatsache, Behauptung zur Überzeugung. Und wer widerspricht, wirkt plötzlich wie jemand, der nicht sehen will.
Unsere Aufgabe? Nicht alles erzählen, was sich erzählen lässt – sondern fragen. Gründlich. Hartnäckig. Und vor allem: bevor das Erzählte zur Realität wird. Nicht danach.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)