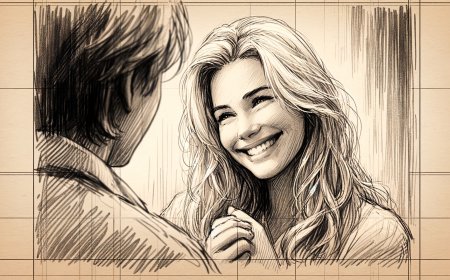Pädagogischer Rahmen: Selbst sichtbar werden - statt dargestellt sein
„Pädagogischer Rahmen – Selbst sichtbar werden - statt dargestellt sein“ ist ein zeitgemäßes Lehrformat für alle, die Wahrnehmung schulen, Räume öffnen und Gestaltung als Spur des Denkens begreifen. Acht Kapitel, Übungen, Reflexionen – und ein Gedanke, der bleibt. Im Sinne von Catharine Remberts Lehre.

Kapitel 5: Der Schatten als Tiefe
Ein Fokus auf Substanz, Wahrnehmungschärfung und innere Bewegung
Schatten sind nicht nur Dunkelheit, sie sind Tiefe. Sie verleihen einer Form Substanz und laden dazu ein, hinter die Oberfläche zu blicken. Indem wir Schatten bewusst einsetzen, lernen wir, nicht nur das Offensichtliche zu sehen, sondern das Verborgene, das Tieferliegende. Diese Praxis schafft Bewusstsein für subtile Wahrnehmung und innere Resonanz.
Ein Schatten zeigt nicht sich selbst – er zeigt, dass etwas da ist. Er ist Spur, Echo, Abdruck. Und zugleich ist er ungreifbar, flüchtig, wandelbar. Wenn wir mit Schatten arbeiten, betreten wir einen Zwischenbereich: zwischen Licht und Dunkel, zwischen Form und Auflösung, zwischen Sichtbarkeit und Geheimnis.
In einer Übung platzieren wir ein einfaches Objekt in ein einzelnes Licht. Die Form tritt zurück – der Schatten wird sichtbar. Wir zeichnen nicht das Objekt, sondern nur seinen Schatten. Oder wir fotografieren ihn, verschieben die Lichtquelle, beobachten, wie sich die Projektion verändert. Ein Strich, der durch Schatten entsteht, ist nicht weniger präzise – nur stiller. Und manchmal bedeutungsvoller.
Digitale Werkzeuge helfen uns, Schattenräume zu untersuchen: Ein LiDAR-Scan etwa zeigt, wie sich Tiefe algorithmisch vermisst – was bleibt dabei auf der Strecke? Und was lässt sich durch digitale Invertierung sichtbar machen, was vorher verborgen blieb? Auch hier: Schatten ist nicht nur optisch. Er ist konzeptionell.
Eine Teilnehmerin sagte einmal:
„Ich dachte, ich sehe nur den Umriss. Aber ich habe mich selbst im Schatten erkannt.“
Schattenarbeit ist auch Spiegelarbeit.
Aufgabenstellung: Mit Schatten gestalten
Ziel: Untersuche die gestalterische Kraft von Schatten. Verwende ein Objekt deiner Wahl – z. B. eine Hand, eine Form, ein Alltagsgegenstand – und inszeniere es mit einer Lichtquelle. Zeichne, fotografiere oder digitalisiere ausschließlich den entstehenden Schatten.
Impulse für die Reflexion:
-
Was erzählt der Schatten, das die Form nicht zeigt?
-
Was verändert sich, wenn das Licht sich ändert?
-
Was bedeutet „Tiefe“, wenn sie nicht tastbar, aber sichtbar wird?
Optionale Erweiterung: Nutze ein digitales Tool (z. B. AR oder LiDAR), um die Schattenwahrnehmung zu analysieren oder zu verfremden – etwa durch Umkehrung, Projektion oder 3D-Mapping.
Lernziele
-
Sensibilität für indirekte Formen stärken: Schatten als Träger von Bedeutung wahrnehmen.
-
Visuelle Tiefe verstehen und gestalten lernen: Licht-Schatten-Dynamiken bewusst einsetzen.
-
Abstraktionsfähigkeit fördern: Vom Gegenstand zur Wirkung denken.
-
Eigenwahrnehmung durch Gestaltung vertiefen: Was spiegelt sich im Ungezeigten?
Pädagogische Prinzipien
-
Wahrnehmung verlangsamen: Schatten verlangt Geduld, genaues Hinschauen.
-
Unsichtbares ernst nehmen: Nicht nur das Explizite hat Bedeutung.
-
Assoziation zulassen: Der Schatten als Projektionsfläche für Emotion, Erinnerung, Unbewusstes.
-
Materialität neu lesen: Ein Schatten braucht keinen Pinsel – nur Licht.
Mögliche Lernmethoden
Atelierarbeit (individuell) - Ein Objekt, eine Lichtquelle – mehr braucht es nicht. Der Schatten wird an die Wand oder auf das Papier geworfen, beobachtet, skizziert oder fotografisch festgehalten. Vielleicht wandert er später ins Skizzenbuch. Vielleicht bleibt er flüchtig. Die Zeichnung folgt nicht der Form, sondern dem Licht.
Digitale Exploration - Schatten werden nicht nur beobachtet, sondern erzeugt – mit digitalen Mitteln. LiDAR-Scans oder Invert-Funktionen machen sichtbar, was dem Auge verborgen bleibt. Schatten verzerren sich, vervielfältigen sich, lösen sich auf. Gestaltung wird hier zur Wahrnehmungsschulung im digitalen Raum.
Geführte Gruppenübung - Im Kreis werden Objekte beleuchtet – nacheinander, wortlos. Jede*r sieht den Schatten des anderen, nimmt ihn auf, übersetzt ihn in Bild oder Sprache. Es entsteht eine Kette von Reaktionen, Assoziationen, Deutungen. Der Schatten wird zum Gesprächspartner – auch ohne Worte.
Bewegte Schattenarbeit - Mit einer Taschenlampe oder einem mobilen Lichtquell bewegt sich der Körper im Raum. Schatten entstehen, verzerren sich, verschwinden. Eine Kamera hält fest, was das Auge kaum fassen kann: die Flüchtigkeit der Geste. Gestaltung in Bewegung – sichtbar gemacht durch Licht und Zeit.
Zum Weiterdenken
Schatten zu gestalten bedeutet, sich dem Nicht-Sichtbaren zuzuwenden. Wir lernen, zu hören, wo niemand spricht. Zu sehen, was nicht glänzt. Und zu erkennen, dass Tiefe nicht immer dort liegt, wo etwas dick aufgetragen wird – sondern oft genau dort, wo etwas fast verschwindet.
Wer Schatten wahrnimmt, sieht mehr – auch im Alltag. In Gesichtern. In Räumen. In Pausen. Vielleicht ist Gestaltung am stärksten dort, wo sie zurücktritt – und Platz lässt für Tiefe.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)