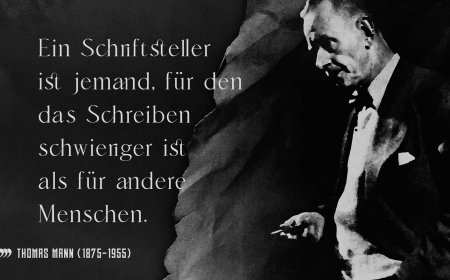Pädagogischer Rahmen: Selbst sichtbar werden - statt dargestellt sein
„Pädagogischer Rahmen – Selbst sichtbar werden - statt dargestellt sein“ ist ein zeitgemäßes Lehrformat für alle, die Wahrnehmung schulen, Räume öffnen und Gestaltung als Spur des Denkens begreifen. Acht Kapitel, Übungen, Reflexionen – und ein Gedanke, der bleibt. Im Sinne von Catharine Remberts Lehre.

Kapitel 1: Die Linie als Entscheidung
Ein Fokus auf Geste, Präsenz und Wahrnehmung
Eine Linie ist niemals nur eine Linie. Sie ist immer eine Entscheidung, eine Setzung, die etwas sichtbar macht und zugleich anderes verbirgt. Catharine Rembert lehrte uns, Linien bewusst und mit Bedacht zu ziehen. Ein Strich bedeutet hier Präsenz, eine Haltung im Raum. Die Linie fordert uns auf, Verantwortung zu übernehmen: Für das, was wir sichtbar machen, und für das, was wir auslassen.
In der Übung „Silent-Drawing“ setzen wir genau da an. Eine einzige Linie, gezogen in sechzig Sekunden, ohne Absetzen, ohne Rücknahme. Was am Anfang nach Einschränkung klingt, wird mit der Zeit zur Befreiung. Denn wenn man nicht zurück kann, muss man sich entscheiden – für Richtung, für Tempo, für Spannung. Es ist, als ob der Stift das Denken überholt und gleichzeitig vertieft. Jeder kleine Schlenker, jede abrupte Wendung trägt Bedeutung. Nicht weil sie perfekt ist, sondern weil sie bezeugt: Ich war da. Ich habe gespürt. Ich habe mich entschieden.
Viele Teilnehmende sagen nach dieser Übung:
„Ich habe zum ersten Mal gemerkt, dass ich zögere, bevor ich beginne.“
Oder: „Ich wusste nicht, dass ich Linien denken kann.“
Es ist kein technisches Zeichnen, das hier geschieht. Es ist ein Nach-Innen-Schauen – und gleichzeitig ein Heraus-Treten. Die Linie wird zur Spur des Moments.
Digitale Werkzeuge helfen, diesen Moment bewusst zu machen. Mit Tablets und sogenannter „Undo-Sperre“ wird das Zurücknehmen blockiert – für drei Sekunden, für fünf. In dieser kurzen Verzögerung liegt ein ganzes Feld an Achtsamkeit. Die Geste, die wir tun, bleibt. Sie bleibt sichtbar, auch wenn sie nicht perfekt ist. Und genau darin liegt ihre Kraft.
Wir sprechen in der Reflexion nicht davon, ob eine Linie „schön“ ist. Wir fragen: Was sagt sie? Welche Entscheidung liegt darin? Was wurde gespürt, was wurde ausgelassen? Die Linie wird zur Sprache – einer Sprache, die keine Wörter braucht. Und je mehr man hinhört, desto klarer erkennt man: Eine Linie kann schreien. Oder flüstern. Oder einfach nur still dastehen, ohne sich erklären zu müssen.
Aufgabenstellung: Silent Line
Ziel: Ziehe eine einzelne Linie in einem festgelegten Zeitraum von 60 Sekunden. Kein Absetzen. Kein Zurücknehmen. Währenddessen (oder danach) dokumentiere deine Gedanken oder Empfindungen: schriftlich, per Audioaufnahme oder durch ein Gespräch.
Varianten für Vertiefung:
-
Wiederhole die Übung täglich über eine Woche – im gleichen Format oder mit variierenden Werkzeugen.
-
Nutze unterschiedliche Medien: Feder, Kohle, Licht, Faden im Raum.
-
Versuche die Linie nicht auf Papier, sondern im Raum – auf einer Glasscheibe, mit Kreide auf Asphalt oder digital in AR.
Lernziele
-
Bewusstsein für Gestaltung stärken: Verstehen, dass jede Linie eine bewusste Entscheidung ist.
-
Wahrnehmung fokussieren: Aufmerksamkeit auf Bewegung, Materialität, Richtung und Pause richten.
-
Reduktion als gestalterische Haltung erfahren: Beschränkung führt zu Konzentration.
-
Selbstreflexion ermöglichen: Durch begleitende Sprache oder Notation den inneren Prozess sichtbar machen.
Pädagogische Prinzipien
-
Prozess vor Produkt: Es geht nicht um das „schöne Bild“, sondern um das Erleben von Linie als Handlung.
-
Wertfreie Beobachtung: Feedback beschreibt Wirkung und Wirkungsmöglichkeiten – ohne Bewertung.
-
Fragendes Denken anregen: Was löst die Linie aus? Welche Möglichkeiten hätte es noch gegeben?
-
Iteration erlauben: Die Linie wiederholt – nicht um sie zu verbessern, sondern um sie besser zu verstehen.
Mögliche Lernmethoden
Selbststudium / individuelles Arbeiten - Die Übung wird als tägliches Ritual ins eigene Skizzenbuch integriert – jeden Tag zur gleichen Uhrzeit, mit einem festen Medium. Ergänzend kann eine kurze schriftliche Reflexion oder ein Audiojournal helfen, Wahrnehmungsveränderungen festzuhalten. Wiederholung wird hier zur Schulung des Blicks.
Atelier-Gruppe / begleitetes Setting - In einer Gruppe entsteht ein gemeinsamer Raum der Stille. Alle zeichnen gleichzeitig, ohne zu sprechen. Danach folgt eine dialogische Betrachtung: „Was sehe ich in deiner Linie?“ – keine Bewertung, sondern Resonanz. Sichtbarkeit entsteht durch Austausch, nicht durch Vergleich.
Digitales Format / Fernlehre - Die Aufgabe wird als kurze Videoanleitung oder Textimpuls bereitgestellt. Teilnehmende laden ihre Ergebnisse (Linie, Foto, Reflexion) in eine geteilte digitale Galerie hoch. Die Linie wird dadurch nicht nur sichtbar, sondern auch dokumentiert – als Spur eines individuellen Prozesses.
Experimentelle Umsetzung / performative Varianten - Die Linie wird nicht gezeichnet, sondern bewegt: mit einem Seil im Raum, mit einem Lichtstrahl in der Dunkelheit, mit Kreide auf dem Asphalt. Die Dokumentation erfolgt fotografisch oder filmisch. Die Linie wird zur Geste im Raum – sichtbar gemacht durch Bewegung.
Zum Weiterdenken
Die Linie ist Ausgangspunkt – aber nie Ziel. Sie ist wie der erste Schritt auf einem leeren Weg: sichtbar, eindeutig, aber offen für das, was folgt. Wer gelernt hat, eine Linie bewusst zu setzen, beginnt anders zu sehen – klarer, ruhiger, vielleicht auch mutiger.
Denn wenn schon eine Linie so viel sagen kann – was sagen dann all die anderen Entscheidungen, die wir täglich treffen?
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)