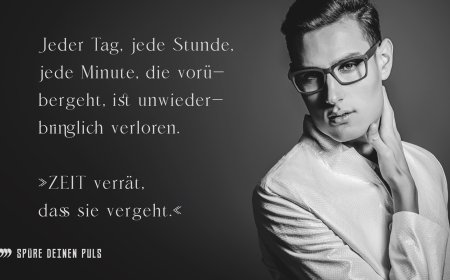Pädagogischer Rahmen: Selbst sichtbar werden - statt dargestellt sein
„Pädagogischer Rahmen – Selbst sichtbar werden - statt dargestellt sein“ ist ein zeitgemäßes Lehrformat für alle, die Wahrnehmung schulen, Räume öffnen und Gestaltung als Spur des Denkens begreifen. Acht Kapitel, Übungen, Reflexionen – und ein Gedanke, der bleibt. Im Sinne von Catharine Remberts Lehre.

Kapitel 2: Der Raum dazwischen
Ein Fokus auf Wahrnehmung, Spannung und das Unsichtbare
Es ist leicht, auf das Sichtbare zu achten. Schwieriger ist es, den Raum dazwischen zu spüren. Doch genau hier liegt die Kraft. Der Zwischenraum spricht, er atmet, er ist nicht leer, sondern voller Potential. In ihm entsteht Dialog. Die Übungen mit Abstand und Leerstellen lehren uns, genau hinzuhören, innezuhalten und Raum zu geben – dem Unausgesprochenen, dem Ungezeichneten.
Was wir zunächst als Leere empfinden, ist oft das Gegenteil: Präsenz in anderer Form. Der Zwischenraum ist kein „Nicht-Ort“, sondern ein Ort des Dazwischen. Zwischen zwei Linien entsteht Spannung. Zwischen zwei Formen entsteht Rhythmus. Zwischen dem, was gesagt wurde, und dem, was nicht ausgesprochen ist, entsteht Bedeutung.
In einer Übung setzen wir zwei schlichte Formen nebeneinander – analog ausgeschnitten oder digital im AR-Raum platziert. Und dann? Dann warten wir. Verschieben sie. Nähern sie an. Entfernen sie wieder. Wir beobachten, was im Raum geschieht – ohne dass sich etwas „bewegt“. Eine Teilnehmerin sagte einmal:
„Ich habe zum ersten Mal gesehen, wie der Abstand selber spricht.“
Diese Erfahrung verändert nicht nur, wie wir gestalten. Sie verändert auch, wie wir wahrnehmen.
Oft ist es dieser Zwischenraum, in dem ein Werk erst lebendig wird. Er macht Platz für das, was nicht eindeutig ist. Für Assoziationen. Für offene Fragen. Für Resonanz. Und diese Resonanz – sie lässt sich nicht erzwingen. Aber sie lässt sich wahrnehmen, wenn wir still genug werden.
Auch in Sprache erleben wir diese Zwischenräume. Eine Pause, ein Innehalten, ein Zögern – sie können mehr sagen als Worte. In der Gestaltung lernen wir, solche Momente nicht zu füllen, sondern ihnen zu vertrauen. Leere als Ausdruck. Nicht als Mangel.
Digital umgesetzt, z. B. durch eine AR-Sandbox, wird diese Leere sogar greifbar: Zwischen zwei virtuellen Objekten entsteht ein realer Wahrnehmungsraum. Man kann ihn umschreiten. Kann schauen, wie Licht fällt. Wie sich Perspektive verändert. Plötzlich wird klar: Der Raum dazwischen ist nicht neutral – er ist aktiv. Und wir sind Teil davon.
Diese Art des Denkens verändert auch unseren Umgang mit Gestaltung insgesamt. Wir fragen nicht mehr nur: Was stelle ich dar? Sondern: Welchen Raum öffne ich? Für wen? Für was? Und was lasse ich bewusst frei?
Aufgabenstellung: Zwischenraum-Komposition
Ziel: Gestalte eine Konstellation aus zwei (oder wenigen) einfachen Formen. Positioniere sie so, dass der Raum dazwischen zum eigentlichen Thema wird. Arbeite mit Papierformen, Objekten im Raum oder digitalen AR-Platzierungen.
Impulse für die Arbeit:
-
Nähe vs. Distanz – wie verändert sich die Spannung?
-
Horizontal vs. vertikal – wie wirkt der Raum?
-
Leerstelle vs. Überlagerung – wann wird etwas zu viel? Wann zu wenig?
Dokumentation: Fotografiere oder skizziere die Konstellationen in unterschiedlichen Stadien. Reflektiere schriftlich oder mündlich: Was hast du gesehen? Was hat sich verändert?
Lernziele
-
Zwischenräume bewusst wahrnehmen und gestalten lernen
-
Sensibilität für Spannung, Rhythmus und Balance entwickeln
-
Gestalterisches Denken vom Objekt zum Beziehungsraum erweitern
-
Achtsamkeit für Leere, Stille und Nicht-Handeln stärken
Pädagogische Prinzipien
-
Material- und Raumresonanz fördern
» Leere als kraftvolles gestalterisches Mittel ernst nehmen. -
Beobachtung statt Interpretation
» Was passiert im Raum – ganz konkret, ohne symbolische Deutung? -
Fragen statt Festlegen
» „Was verändert sich, wenn…?“ als wiederkehrender Impuls. -
Prozessorientiertes Arbeiten ermöglichen
» Es gibt kein fertiges Bild – nur ein Prozess der Annäherung.
Mögliche Lernmethoden
Selbststudium / Atelierarbeit - Die Übung wird im eigenen Tempo erarbeitet: Teilnehmende ordnen Objekte im Raum an – analog oder digital –, fotografieren oder skizzieren sie, variieren Licht und Abstand. Der Fokus liegt auf dem Sehen: Wo beginnt Spannung? Was entsteht im Zwischenraum? Eine stille Schule der Beobachtung.
Gruppenübung / Präsenzformat - In einer Gruppe werden Formen gemeinsam platziert – am Tisch, auf dem Boden, an der Wand. Die Beobachtung richtet sich weniger auf das Einzelne als auf das Verhältnis: Wie verändert sich die Wirkung durch kleine Verschiebungen? Im Kreis werden Eindrücke ausgetauscht. Keine Bewertung, nur Wahrnehmung.
Digital / Online-Atelier - Virtuelle Formen werden mithilfe von AR-Apps oder kollaborativen Whiteboards platziert. Die Teilnehmenden arbeiten im geteilten Raum – sehen einander, kommentieren, verschieben. Gestaltung wird hier zur sozialen Praxis: Jede Setzung beeinflusst das Ganze. Der Bildschirm wird zum Resonanzraum.
Körper-Raum-Übung - Formen und Abstände werden mit dem eigenen Körper erfahren. Zwei Stühle, ein Lichtkegel, ein Schritt nach vorn oder zurück. Nähe und Distanz werden nicht nur gesehen, sondern gespürt. Im Anschluss werden die Eindrücke skizziert, beschrieben, ins Verhältnis gesetzt. Der Körper denkt mit.
Zum Weiterdenken
Wenn Raum nicht „Hintergrund“ ist, sondern Träger von Bedeutung, verändert sich alles. Gestaltung wird zum Eröffnen von Zwischenräumen – nicht zum Ausfüllen von Flächen. Der Zwischenraum lehrt uns, dass Nicht-Handeln ebenso Ausdruck sein kann wie Tun. Und dass wir, wenn wir Gestaltung ernst nehmen, nicht nur die Formen setzen – sondern auch entscheiden, was wir frei lassen.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)