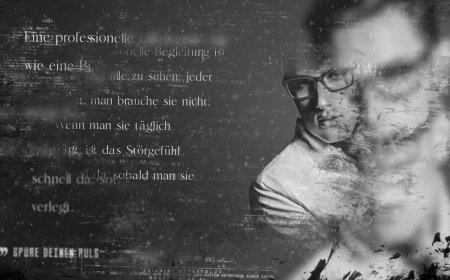Pädagogischer Rahmen: Selbst sichtbar werden - statt dargestellt sein
„Pädagogischer Rahmen – Selbst sichtbar werden - statt dargestellt sein“ ist ein zeitgemäßes Lehrformat für alle, die Wahrnehmung schulen, Räume öffnen und Gestaltung als Spur des Denkens begreifen. Acht Kapitel, Übungen, Reflexionen – und ein Gedanke, der bleibt. Im Sinne von Catharine Remberts Lehre.

Bevor die eigentlichen Gestaltungsexperimente beginnen, ist es sinnvoll, einen Schritt zurückzutreten. Nicht, um etwas zu planen. Sondern um zu klären, was uns trägt. Denn was hier geübt wird, hat mit mehr zu tun als mit Technik. Es hat mit Wahrnehmung zu tun. Mit Aufmerksamkeit. Und mit dem Vertrauen, dass Gestaltung ein Weg sein kann – kein Ziel.
Wer sich auf diesen Prozess einlässt, beginnt mit einer Haltung, nicht mit einer Methode. Deshalb ist dieser Prolog kein Vorwort im klassischen Sinn. Er ist ein Raum. Ein Denkraum, ein Wahrnehmungsraum, ein Raum der Öffnung. Er markiert nicht den Anfang eines Curriculums, sondern den Übergang in eine Praxis des Sehens.
Geschichtliche Spur: Wer war Catharine Rembert?
Catharine Rembert arbeitete leise. Ihr Weg verlief am Rand der etablierten Systeme – und genau dort entwickelte er Kraft. In einer Nachkriegszeit voller Umbrüche und neuer Ordnungen verstand sie Gestaltung nicht als Ornament, sondern als eine Form der Auseinandersetzung mit Welt und Wahrnehmung.
Ihre Pädagogik war einfach, aber nicht simpel: Reduzieren. Beobachten. Wiederholen. Sie glaubte an die Kraft der Wiederkehr, an das Unscheinbare. Und sie vertraute darauf, dass jede gestalterische Handlung zugleich eine innere Bewegung ist. In dieser Tradition stehen auch die Übungen, die hier vorgeschlagen werden: Sie bieten keine Lösungen, sondern Möglichkeiten, aufmerksam zu werden.
Sehen lernen: Räume, Linien, Material
Gestaltung beginnt mit dem Sehen. Aber nicht mit dem schnellen Blick – sondern mit dem verweilenden. Positiv- und Negativraum, Linie und Leere, Material und Geste – das sind keine Vokabeln, sondern Beziehungen. Wer eine Linie zieht, entscheidet. Wer einen Raum lässt, vertraut. Wer Material berührt, setzt eine Spur – und empfängt eine Antwort.
Wachs hat eine andere Stimme als Kreide. Der Schatten spricht anders als die Form. Auch ein digitales Werkzeug ist nicht neutral – es formt mit. Und wir lernen ihm zuzuhören.
Analog und digital – kein Gegensatz
Kreide, Tablet, Papier, AR – wir unterscheiden nicht nach Technik, sondern nach Haltung. Die Undo-Sperre eines Tablets wird zum Schulungsraum für Entschiedenheit. Ein digitaler Glitch wird nicht gelöscht, sondern gelesen. Gestaltung mit digitalen Mitteln ist Teil unserer Wirklichkeit – sie verlangt dieselbe Aufmerksamkeit wie jede andere Spur. Vielleicht manchmal sogar mehr.
Was zählt, ist nicht das Tool – sondern wie wir ihm begegnen. Und was wir damit sichtbar machen, für uns und für andere.
Vielfalt sehen, Vielfalt gestalten
Gestaltung ist nicht neutral. Sie wird gemacht – und gelesen. Von unterschiedlichen Menschen, in unterschiedlichen Sprachen, mit unterschiedlichen Sinnen. In diesem Rahmen wird Inklusion nicht „mitgedacht“, sondern vorausgesetzt: Nicht alles muss für alle gleich sein – aber alles kann für viele zugänglich gemacht werden.
Wir gestalten hörend, tastend, lesend, zeichnend, sprechend. Und vor allem: gemeinsam. Die Differenz ist keine Hürde. Sie ist das Material, aus dem unsere gemeinsame Sprache entsteht.
Gestaltung im Kontext
Gestaltung ist Beziehung. Sie steht nicht für sich selbst – sie tritt in Resonanz. Mit einem Raum. Mit einer anderen Form. Mit einer Linie, die nicht von uns ist. Gestaltung bedeutet auch: zuhören. Und manchmal: sich enthalten.
Was wir hier lernen, lässt sich nicht nur in Skizzenbüchern anwenden. Es betrifft auch die Art, wie wir Räume betreten. Wie wir sprechen. Wie wir uns zeigen – oder nicht.
Was dieser pädagogische Rahmen meint – und was er nicht meint
Wenn wir von einem pädagogischen Rahmen sprechen, meinen wir keinen festen Plan. Keine Abfolge von Übungen, die auf ein definiertes Ziel hinauslaufen. Wir meinen einen Raum mit Orientierung – aber ohne Richtungsvorgabe. Einen Rahmen, der trägt, aber nicht festhält. Einen Zusammenhang, der Form gibt – ohne zu formen.
Dieser Rahmen ist durchlässig. Er erlaubt Fragen, Abweichungen, Pausen. Er versteht sich als Resonanzfläche für Prozesse, die nicht linear verlaufen. Als Einladung zum Mitdenken – nicht zum Nachvollziehen.
Er ist keine Struktur im klassischen Sinn. Er ist ein Gestaltungsraum für Wahrnehmung – offen, fragmentarisch, wiederholbar. Und gerade deshalb tragfähig.
Was dieser Rahmen will
Dieser Rahmen will nicht erklären. Er will öffnen. Räume schaffen, in denen etwas entstehen kann – im eigenen Blick, in der Geste, im Austausch. Er versteht Gestaltung nicht als Ergebnis, sondern als Begegnung: zwischen Sehen und Handeln, zwischen Tun und Lassen, zwischen Form und Fragment.
Er bietet keine Rezepte. Stattdessen: Übungen, die aufmerksamer machen. Texte, die nicht bewerten, sondern begleiten. Methoden, die zu Fragen führen, nicht zu Lösungen.
Denn was wir hier üben, ist mehr als Zeichnen.
Es ist eine Schule der Wahrnehmung.
Für das, was sichtbar wird –
und für das, was wir bewusst offen lassen.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)