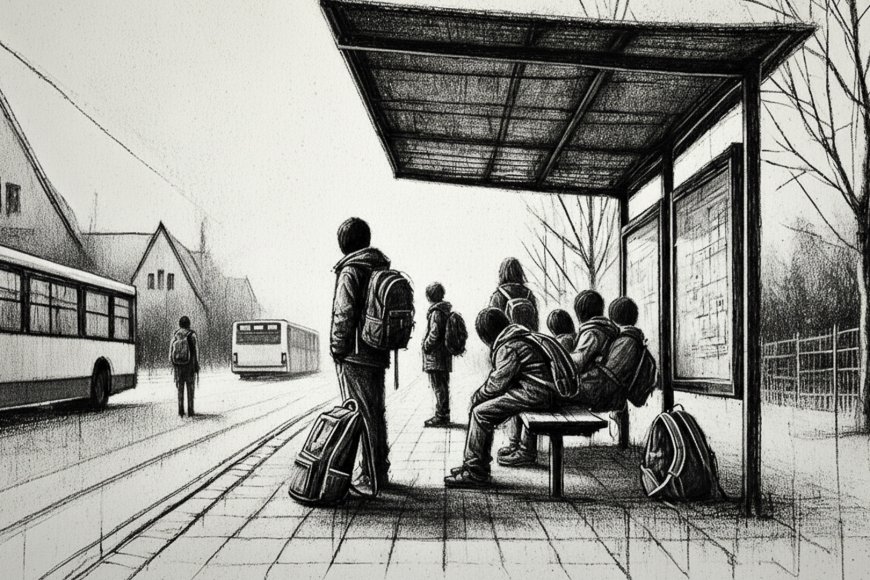Der Maskierungseffekt: Die Illusion vom Lärm – und was sie über uns verrät
Wie kann weniger Lärm zu mehr Belastung führen? Dieses Manuskript beleuchtet den Maskierungseffekt – ein akustisches Phänomen, bei dem scheinbare Ruhe einzelne Geräusche plötzlich störend hervortreten lässt. Ein erkenntnisreicher Blick auf Klang, Raum und Wahrnehmung.
Was ist Ihre Reaktion?
 Gefällt mir
0
Gefällt mir
0
 Gefällt mir nicht
0
Gefällt mir nicht
0
 Liebe
0
Liebe
0
 Lustig
0
Lustig
0
 Wütend
0
Wütend
0
 Traurig
0
Traurig
0
 Wow
0
Wow
0