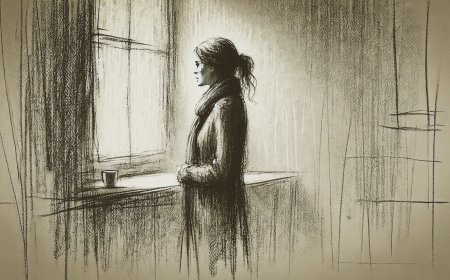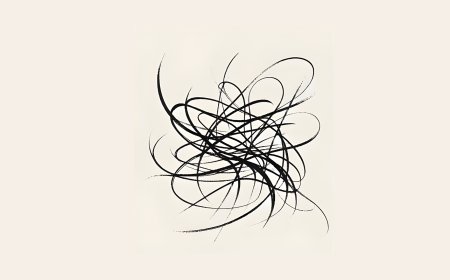Wohnraum, Wahrheit, Verwaltungsakte – Die Debatte
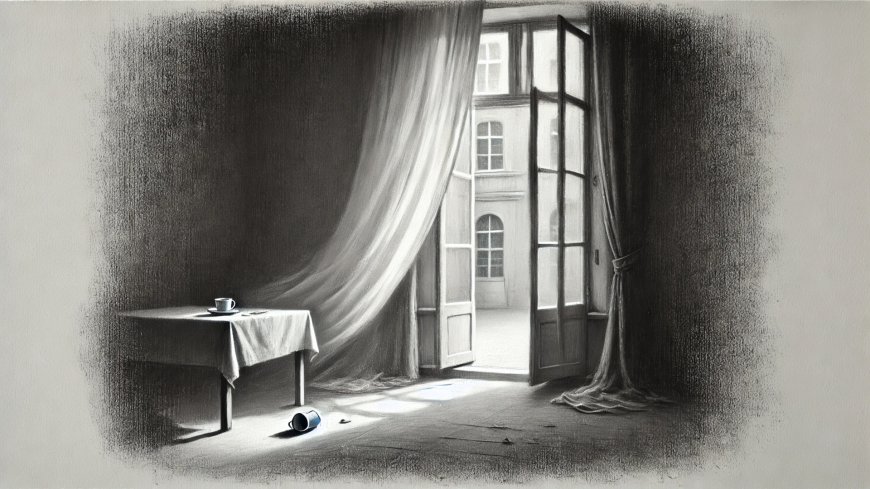
Kapitel 7: Gegenprüfung: Infrastruktur, Integration, Lebensrealität
Keine Hinweise auf Überlastung
Wenn nichts aus dem Rahmen fällt – außer der Blick auf die Wirklichkeit
Manchmal ist das Auffälligste das, was nicht auffällt.
Kein besonderer Müllberg vor der Tür. Keine überlaufenen Spielplätze. Kein erhöhtes Polizeiaufkommen. Keine Flut von Beschwerden im Rathaus. Keine öffentlichen Sitzungen mit Tagesordnungspunkt „Marktstraße – Notlage“. Und das allein ist bereits eine Nachricht.
Denn in einer Stadt, in der viel über „Überbelegung“, „Unruhe“ und „Belastung“ gesprochen wird, müsste man – sollte das alles stimmen – eigentlich auch entsprechende Spuren finden. Im Protokoll. Im System. In der Verwaltung. Im Alltag.
Aber: Diese Spuren fehlen.
Die Müllentsorgung erfolgt regulär. Die Tonnen werden gestellt nach Anzahl der gemeldeten Bewohner:innen. Und sie werden abgeholt – pünktlich, planmäßig, ohne Ausnahme.
Keine Berichte über „außergewöhnliche Mengen“. Keine Sonderleerungen. Keine Beschwerden der Entsorgungsbetriebe. Keine Mahnungen.
Auch bei den Stadtwerken: keine Unregelmäßigkeiten. Wasser- und Stromverbrauch im erwartbaren Bereich.
Keine Lastspitzen. Keine Auffälligkeiten. Keine Beanstandungen von Netzbetreibern oder Vermieter:innen.
Die Schulen? Die Kita? Die medizinische Versorgung? Alles im Rahmen.
Kein dramatischer Anstieg. Kein überdurchschnittlicher Betreuungsbedarf. Keine Krisensitzung, keine Wartelisten, keine Überlastungsanzeige durch Träger oder Einrichtungen.
Was bedeutet das?
Es bedeutet, dass die Systeme greifen. Dass die Marktstraße – ganz nüchtern betrachtet – funktioniert. Nicht perfekt. Nicht störungsfrei. Aber funktional.
Und genau das ist der Punkt: Die öffentliche Darstellung einer „Überforderung“ steht im krassen Gegensatz zu den realen Abläufen vor Ort.
Wenn in zwei Häusern angeblich 30 oder 50 Personen leben – warum schlägt dann keine einzige zuständige Stelle Alarm?
Wieso gibt es keine Brandschutzmeldung? Keine Wohnraumkontrolle? Kein Einschreiten des Bauamts?
Weil nichts davon nötig war.
Die Marktstraße hat nicht „versagt“. Sie wurde verkürzt dargestellt.
Und zwar auf eine Weise, die nicht den Zustand der Infrastruktur spiegelt – sondern den Zustand der Erzählung über sie.
Und diese Erzählung braucht keinen Nachweis.
Sie lebt von einem Gefühl. Von einem „Das kann doch nicht sein“. Von einem Misstrauen, das nicht durch Beobachtung entstanden ist – sondern durch Wiederholung.
Doch eine Gesellschaft, die auf Gefühl verwaltet, verliert die Kontrolle.
Sie braucht Zahlen. Verfahren. Daten. Belege.
Und dort, wo alle Zahlen im Normalbereich liegen – da gibt es keinen Platz für Ausnahmerhetorik.
Natürlich kann es Konflikte geben. Zwischenmenschlich. Nachbarschaftlich. Emotional. Aber daraus entsteht keine „Überforderung“ der Stadt – sondern höchstens ein Gesprächsbedarf.
Und der lässt sich nicht mit dem Begriff „Zustände“ beschreiben. Sondern mit dem Wort: Alltag.
Einordnung der Belegung in Sozialstandards
Wenn Wohnen nicht aus dem Rahmen fällt – sondern exakt hineinpasst
Wieviel Platz braucht ein Mensch? Wie viel Raum gilt als angemessen? Und ab wann spricht man eigentlich von „Überbelegung“? Diese Fragen lassen sich nicht aus dem Bauch heraus beantworten. Sie sind geregelt – in Richtlinien, Verwaltungsvorschriften, Tabellen –, auf die täglich zugegriffen wird: von Sachbearbeiter:innen, Wohnraumberater:innen, Sozialträgern, Jobcentern, Gerichten.
Die Antwort auf diese Fragen hängt nicht von Empörung ab. Sondern von Standards.
Und diese Standards sagen:
» Für einen Alleinstehenden gelten in der Regel 45 m² als angemessen.
» Für zwei Personen: 60 m².
» Für jede weitere Person: rund 15 m² zusätzlich.
So steht es – je nach Bundesland und Kommune – in den örtlichen Ausführungshinweisen zu §22 SGB II.
Und nun zur Marktstraße:
Die beiden Häuser (Nr. 151 und 191) verfügen laut Versicherungsunterlagen über eine Gesamtwohnfläche von rund 411 m², aufgeteilt auf acht Wohneinheiten. Das ergibt einen Durchschnitt von über 50 m² pro Wohnung. In diesen acht Wohnungen leben – Stand Melderegister und geprüfte BG-Daten – dreizehn Personen.
Das ergibt rein rechnerisch:
» Rund 31,6 m² pro Person
» Oder: ein Wohnwert, der exakt innerhalb der geltenden Sozialstandards liegt.
Hier ist nichts „zu eng“. Nichts „überbelegt“. Nichts außerhalb der Norm.
Mehr noch: Die Wohnungen wurden saniert, vermietet, geprüft. Die Mietverträge wurden vom Jobcenter akzeptiert. Die Fläche ist pro Bedarfsgemeinschaft nicht nur angemessen – sie liegt sogar oberhalb der Mindestwerte. Und niemand lebt dort „unterhalb des Existenzminimums“ oder „in unzumutbaren Verhältnissen“, wie es gelegentlich suggeriert wird.
Diese Belegung ist nicht nur rechtlich zulässig, sondern auch sozial verträglich. Und sie entspricht genau dem, was die kommunale Praxis in tausenden Städten täglich umsetzt:
» Nicht das Idealmaß zählt – sondern das, was möglich, machbar und menschenwürdig ist.
Dreizehn Personen auf 411 m² – das ist keine Belastung.
Das ist: entspanntes Wohnen.
Weder eine Sammelunterkunft. Noch eine Sonderlösung. Sondern: ganz normale Mietverhältnisse, in ganz normalem Rahmen, mit ganz normalen Rechten.
Und genau deshalb ist die Zahl „30 bis 50 Personen“ so folgenreich. Weil sie den Anschein erweckt, es handele sich um ein gesondertes Phänomen. Um ein Sonderproblem. Dabei ist das Gegenteil der Fall:
Hier wurde nichts ausgereizt. Hier wurde schlicht vermietet.
Und das ist wichtig zu sagen. Denn: Sprache verschiebt Realität. Und wenn wir davon sprechen, dass hier „etwas nicht mehr tragbar“ sei, dann müssen wir uns fragen: Was genau? Die Quadratmeterzahl? Die Anzahl der Mietparteien? Oder doch nur das Bild, das daraus gemacht wurde?
Keine Sonderrolle – keine Ausnahme
Wenn das Normale zum Sonderfall erklärt wird – nur weil es politisch besser passt
Ein Haus mit acht Wohnungen. Eine Handvoll Familien. Alles gemeldet. Alles geprüft. Alles im Rahmen. Und trotzdem entsteht das Gefühl: „Da stimmt doch was nicht.“ Warum? Weil dieses Haus – und das daneben – in den vergangenen Monaten zur Ausnahme erklärt wurden. Nicht durch Gesetz. Nicht durch Verwaltung. Sondern: durch Erzählung.
Die Häuser Marktstraße 151 und 191 sind keine Sonderimmobilien.
Keine kommunalen Objekte, keine Asylunterkünfte, keine Übergangsquartiere, keine Heime, keine „Sonderlösungen“. Es sind ganz normale Wohnhäuser – saniert, versichert, vermietet.
Eigentum eines privaten Vermieters.
Belegt von Bedarfsgemeinschaften, die über das ganz normale System angemeldet, registriert und verwaltet wurden.
Es gibt keinen Sonderstatus.
Keine Erleichterungen.
Keine Umgehungen.
Alle Mietverträge wurden individuell geprüft – vom Jobcenter, von der Meldebehörde, von der Verwaltung. Und das bedeutet:
Jede einzelne dieser Familien hat sich genau an das gehalten, was das Gesetz verlangt.
Und trotzdem:
» In Berichten ist von „Zuständen“ die Rede.
» In Landtagssitzungen wird das Thema aufgerufen wie ein strukturelles Problem.
» In öffentlichen Gesprächen schwingt immer wieder mit: „Da gelten andere Regeln.“
Aber das ist falsch.
Nicht in einem einzigen Punkt wurde festgestellt, dass es hier eine Ausnahme gab.
Keine Sondergenehmigung. Kein Durchwinken. Kein „unter der Hand“. Alles liegt offen vor. Alles ist belegbar. Und das sollte eigentlich reichen.
Doch offenbar reicht es nicht – weil die öffentliche Wahrnehmung inzwischen einer anderen Logik folgt:
Was oft genug als Sonderfall dargestellt wird, wirkt irgendwann wie einer.
Doch diese Wirkung ist trügerisch. Denn sie verkennt:
» dass Normalität nicht schrill ist,
» dass rechtskonformes Wohnen keine Geschichte schreibt,
» und dass die Stillen oft nur dann gehört werden, wenn andere für sie sprechen – oder gegen sie.
In dieser Stadt, in dieser Straße, in dieser Debatte wurde nichts Außergewöhnliches gemacht.
Außer, dass man aus dem Gewöhnlichen eine Bühne gebaut hat.
Aus der Wohnadresse ein Fall. Aus der Aktenlage ein Narrativ. Und aus Mieter:innen Störenfriede.
Doch ein Mietverhältnis wird nicht dadurch besonders, dass viele darüber reden.
Es wird besonders durch seinen Schutz – im Recht. In der Verwaltung. In der Gesellschaft.
Und dieser Schutz gilt – nicht weniger, sondern besonders dann, wenn andere anfangen, daran zu zweifeln.
Nicht, weil ein Haus auffällt, sondern weil sein Schutz nicht verhandelbar ist.
Marktstraße 151 und 191:
Kein Sonderfall. Keine Ausnahme. Kein politisches Exempel.
Sondern: zwei Häuser mit Menschen, die wohnen.
Mehr nicht. Und damit: alles, was zählt.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)