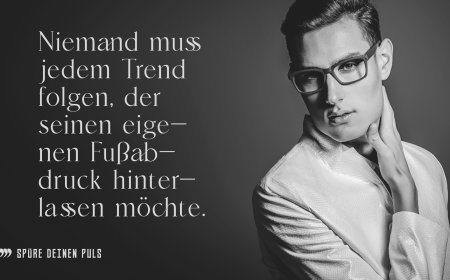Wohnraum, Wahrheit, Verwaltungsakte – Die Debatte
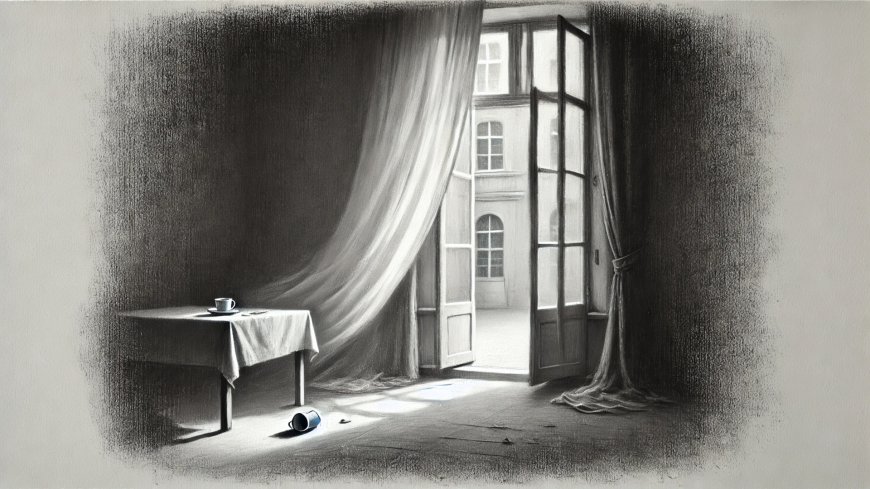
Kapitel 5: Der Entmietungsversuch: Rechtslage, Bewertung, Risiko
Alternative Wohnangebote im NDR-Beitrag
Wenn zwei Wohnungen plötzlich für dreizehn Menschen reichen sollen
Im NDR-Beitrag vom 30. Juli 2025 gibt es einen unscheinbaren Moment – ein Nebensatz, fast beiläufig gesprochen, aber mit erheblicher Sprengkraft: Es wird davon gesprochen, dass zwei Wohnungen angeboten wurden. An die Bewohner:innen der Häuser in der Marktstraße. Als Alternative. Als Möglichkeit. Als „Angebot zur Verbesserung der Lage“.
Was sich hier sprachlich harmlos gibt – entpuppt sich bei näherem Hinsehen als ein tiefgreifender Eingriff. Denn das, was hier als Hilfsangebot beschrieben wird, hätte im Ergebnis bedeutet: die Entmietung zweier Wohnhäuser. Ohne gerichtliche Grundlage. Ohne Verfahren. Ohne Zustimmung.
Zwei Wohnungen – für dreizehn Personen. Das ist keine „soziale Lösung“. Das ist eine faktische Rückabwicklung bestehender Mietverhältnisse. Und im Kontext der öffentlichen Debatte: ein politisches Signal.
Denn niemand muss umziehen, wenn es keinen Kündigungsgrund gibt. Niemand muss sich „verbessern“, wenn das Bestehende bereits rechtlich gesichert ist. Und niemand darf unter Druck gesetzt werden – erst recht nicht durch die Botschaft: „Wenn ihr geht, wird’s ruhiger.“
Das wäre nicht Hilfe – das wäre Verdrängung.
Doch was steckt hinter diesem Angebot? Wer hat es unterbreitet? Und mit welcher Absicht? Laut Berichterstattung wurde das Angebot von städtischer Seite geprüft oder ins Spiel gebracht – möglicherweise in Abstimmung mit dem Landkreis oder weiteren Stellen. Aber: weder der Beitrag noch begleitende Aussagen liefern klare Namen, Zuständigkeiten oder Kriterien.
Es bleibt nebulös. Und genau das ist das Problem.
Denn hinter dieser Geste verbirgt sich ein gefährlicher Präzedenzfall:
– Dass bestehende Mietverhältnisse plötzlich „zur Disposition“ stehen – obwohl sie korrekt sind.
– Dass Leistungsbezieher:innen suggeriert wird, sie könnten „freiwillig“ gehen – obwohl der Druck spürbar ist.
– Dass stimmungsgetriebene Erzählungen zum Auslöser verwaltungspolitischen Handelns werden.
Zwei Ersatzwohnungen für acht Haushalte?
Das ist rechnerisch nicht plausibel, rechtlich nicht haltbar – und gesellschaftlich kaum zu vermitteln.
Denn was passiert, wenn so etwas Schule macht?
Wenn Kommunen beginnen, Konflikte dadurch zu „lösen“, dass sie die Sichtbaren umsiedeln – statt die Ursachen zu analysieren?
Dann ist nicht nur das Mietrecht in Gefahr.
Sondern das soziale Fundament, auf dem unser Gemeinwesen ruht.
Wer also glaubt, mit zwei Wohnungen „etwas Gutes“ zu tun, sollte sich fragen, was eigentlich als Problem definiert wurde.
Die Belegung? Die Familienstruktur? Die Adresse? Die Herkunft?
Oder ist das Angebot am Ende gar keine Hilfe – sondern ein Umweg, um einem politischen Wunsch nachzugeben, ohne sich offen zur Absicht zu bekennen?
Fest steht: Ein freiwilliger Umzug ist nur dann freiwillig, wenn keine Erwartung im Raum steht.
Kein subtiles Framing. Keine verdeckten Drohkulissen.
Keine Berichte im Fernsehen, die suggerieren: „Wenn sie klug sind, nehmen sie das Angebot an.“
Wohnraum ist keine Kulisse für Schlichtungsversuche.
Und schon gar kein Ausgleich für politisch erzeugte Empörung.
Voraussetzungen für rechtmäßige Umsetzungen
Was erlaubt ist – und was auch bei gutem Willen nicht geht
In einer Demokratie ist nicht alles möglich, nur weil es gut gemeint ist. Und nicht jede Idee, die nach Entlastung klingt, hält einer rechtlichen Prüfung stand. Genau das gilt für den Versuch, die Bewohner:innen der Marktstraße „umzusiedeln“ – auch wenn man es freundlicher verpackt als „Angebot alternativer Wohnungen“.
Denn für jede Veränderung des Wohnsitzes gilt: Sie muss freiwillig, informiert, rechtskonform und verhältnismäßig sein. Das ist kein Wunschkatalog. Das ist der Rahmen, den Gesetze wie das BGB, das SGB und die Grundrechte gemeinsam stecken.
Damit eine Umsiedlung – egal ob im Einzelfall oder kollektiv – rechtlich Bestand hätte, müssten mehrere Voraussetzungen erfüllt sein:
- Es muss ein objektiv nachvollziehbarer Grund vorliegen.
Nicht: „Die Nachbarn fühlen sich gestört.“
Sondern: „Es liegt eine schwerwiegende Vertragsverletzung vor.“
Nicht: „Es wohnen zu viele Menschen dort.“
Sondern: „Die Belegung überschreitet die zulässige Grenze – nachweislich.“
In der Marktstraße aber: kein Lärmprotokoll, keine Ordnungsverfügung, kein Baurechtsverstoß. - Die Zustimmung der betroffenen Personen muss frei und ohne Druck erfolgen.
Ein Angebot ist nur dann ein Angebot, wenn es keine Konsequenzen nach sich zieht.
Wenn jedoch gleichzeitig Berichte, Aussagen von Mandatsträgern und mediale Bilder kursieren, dann entsteht kein neutraler Raum für Entscheidungen.
Dann entsteht ein Erwartungsdruck. Und Druck ist keine Entscheidungsfreiheit. - Die Alternativangebote müssen zumutbar, gleichwertig und realistisch sein.
Zwei Wohnungen – für dreizehn Personen, aufgeteilt auf acht Bedarfsgemeinschaften – erfüllen dieses Kriterium nicht:
» Weder räumlich,
» noch wirtschaftlich,
» noch organisatorisch.
Die betroffenen Mieter:innen haben laufende Verträge. Gekündigt hat niemand.
Auch das Jobcenter hat keine Maßnahmen angekündigt oder eingeleitet. - Es darf keine administrative Benachteiligung entstehen.
Wenn das „Angebot“ an die implizite Botschaft gekoppelt wird: „Wenn ihr nicht umzieht, bleibt alles, wie es ist“,
wird daraus eine versteckte Drohung.
» Das widerspricht dem Gleichheitsgrundsatz.
» Es verletzt das Prinzip der freiwilligen Mitwirkung.
» Es gefährdet das Vertrauen in kommunales Verwaltungshandeln. - Die rechtliche Tragfähigkeit muss dokumentiert und überprüfbar sein.
In diesem Fall: Nichts davon. Keine schriftlichen Vereinbarungen, keine Nachweise, keine transparente Information.
Die Aussage im NDR-Beitrag steht im Raum – aber ohne Kontext, ohne Dokumentation, ohne nachvollziehbare Struktur.
Wenn so etwas nicht belegbar ist, bleibt es ein Gerücht. Oder – schlimmer – eine gezielte Strategie zur Entmietung.
Fazit dieses Abschnitts:
Rechtmäßigkeit beginnt nicht mit der guten Absicht, sondern mit dem klaren Verfahren.
Wer bestehende Mietverhältnisse antasten will, muss Rechtsgrundlagen, Zustimmung, Zumutbarkeit und Verhältnismäßigkeit nachweisen.
All das fehlt hier.
Was bleibt, ist ein Angebot, das sich bei Licht betrachtet nicht als Entlastung, sondern als Ersatzhandlung entpuppt – weil man ein Problem lösen wollte, das in Wahrheit keins war.
Unzulässigkeit einer administrativen Entmietung
Was nicht gefällt, darf nicht verschwinden – jedenfalls nicht in einem Rechtsstaat
Die Idee, dass eine Verwaltung oder ein politisches Gremium Menschen aus ihren Wohnungen „entfernen“ kann – nicht auf Grundlage eines Gerichtsbeschlusses, sondern durch administrative Einwirkung –, ist verstörend. Und doch stand sie in Loitz unausgesprochen im Raum. Nicht als direkter Befehl, sondern als schleichende Strategie: Angebote. Umsiedlungspläne. Gesprächsangebote. Einvernehmliche Lösungen.
Klingt harmlos. Ist es aber nicht. Denn rechtlich betrachtet handelt es sich dabei um eine Form von faktischer Entmietung – also den Versuch, Wohnverhältnisse außerhalb des juristisch vorgesehenen Weges zu beenden. Ohne Kündigung. Ohne Gericht. Ohne förmliche Begründung. Und vor allem: ohne Schuldnachweis.
Das Mietrecht in Deutschland schützt Mieter:innen bewusst stark – gerade weil Wohnen ein elementares Grundrecht ist. Artikel 13 des Grundgesetzes spricht von der Unverletzlichkeit der Wohnung. §573 BGB schützt vor ordentlichen Kündigungen ohne berechtigtes Interesse. Sozialrecht und Meldepflicht sichern die Rechte auch jener ab, die keine ökonomische Macht haben – sondern nur ein Dach über dem Kopf.
In diesem System gibt es keinen Platz für stillschweigende Räumung.
Wenn einer Familie, die nichts falsch gemacht hat, „alternativer Wohnraum“ angeboten wird – unter der impliziten Erwartung, sie möge doch bitte mitziehen –, dann ist das keine Hilfsmaßnahme. Sondern eine Umgehung. Eine elegante, vielleicht sogar absichtsvoll verklausulierte Form von Verdrängung ohne Legitimation.
Diese Praxis – man muss es so deutlich sagen – ist nicht zulässig.
» Es fehlt an einem Kündigungsgrund.
» Es fehlt an einem Verwaltungsakt.
» Es fehlt an Transparenz.
» Es fehlt an Widerspruchsmöglichkeiten.
» Es fehlt an Öffentlichkeit.
Kurz: Es fehlt an allem, was einen legitimen Eingriff in bestehende Mietverhältnisse ausmachen würde.
Und das Gefährliche daran: Weil keine offizielle Maßnahme vorliegt, können sich die Betroffenen nicht wehren. Es gibt keine Akte. Keine Rechtsmittel. Keine Anhörung. Nur die Entscheidung, ob man sich „dem Vorschlag“ beugt – oder aushält, was danach kommt.
Das ist nicht nur rechtsstaatlich bedenklich. Es ist sozial brandgefährlich. Denn es sendet ein Signal: „Wenn du auffällst, verlierst du deinen Platz.“ Und dieses Signal trifft nicht nur die Betroffenen – sondern alle, die am Rand stehen.
Verwaltungen dürfen nicht nach Stimmungslage handeln. Auch nicht nach medialem Druck. Sie sind dem Recht verpflichtet – nicht der Schlagzeile.
Die Adressen Marktstraße 151 und 191 sind keine politischen Problemzonen. Sie sind Wohnorte. Mit Mietverträgen. Mit Stromzählern. Mit Schultaschen im Flur.
Und wer glaubt, er könne sie „aus der Debatte nehmen“, indem er sie leert, verwechselt Politik mit Kulissenschieberei.
Wem die Realität nicht gefällt, muss sie nicht räumen. Er muss sie aushalten.
Oder anders gesagt:
Wohnungen sind keine Stellvertreter für gesellschaftliche Konflikte. Und Mieter:innen keine Spielfiguren.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)