Wohnraum, Wahrheit, Verwaltungsakte – Die Debatte
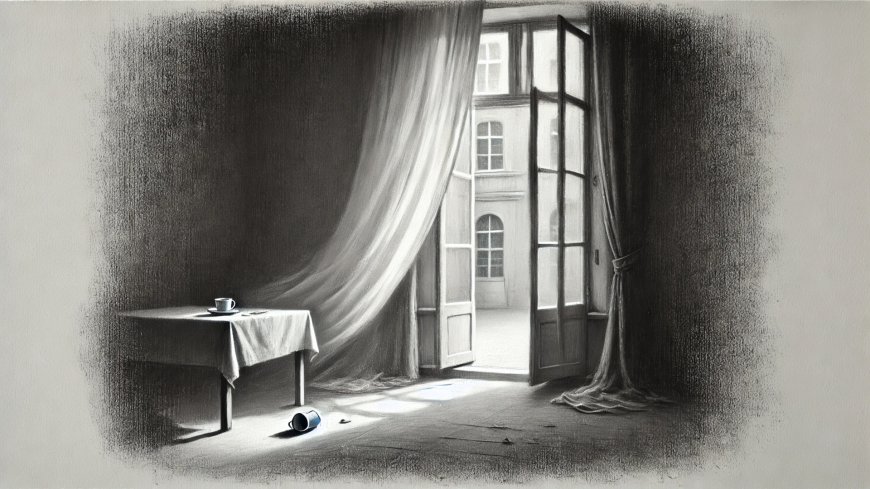
Kapitel 2: Wohnflächen und belegbare Realität
Flächendaten aus den Unterlagen
Was sich messen lässt – und was daraus folgt
Wenn man sich der Wahrheit annähern will, lohnt es sich, mit dem anzufangen, was sich zählen lässt. Nicht die Menschen. Nicht die Gerüchte. Sondern die Quadratmeter. Denn die Fläche lügt nicht. Sie ist vermessen. Belegt. Erfasst. Und vor allem: Sie steht nicht zur Diskussion – sie steht in den Akten.
Zwei Häuser. Acht Wohnungen. Beide Gebäude sind versichert – bei der Allianz, ganz regulär. Keine Schrottimmobilien, keine verwinkelten Altbauten, bei denen keiner weiß, was eigentlich wo beginnt und endet. Sondern: konkrete Objekte, mit konkreten Werten, dokumentiert auf wenigen Seiten.
Haus 151 – vier Wohnungen mit Wohnflächen von 35, 50, 80 und 60 Quadratmetern.
Haus 191 – vier Wohnungen mit 115, 40, 50 und 25 Quadratmetern.
Rechnet man zusammen – und zieht dabei leerstehende Gewerbeflächen ab –, ergibt sich eine vermietbare Wohnfläche von rund 411 Quadratmetern.
Das ist kein Eindruck. Keine gefühlte Wahrheit. Das ist ein harter, prüfbarer Wert.
Und dieser Wert ist entscheidend. Denn wenn öffentlich behauptet wird, dass sich 30, 40 oder gar 50 Menschen in diesen beiden Häusern aufhalten, muss diese Behauptung eine einfache Gegenfrage aushalten: Wohin denn bitte?
Rechnet man – rein rechnerisch – mit der Maximalzahl, also 50 Personen auf 411 m², ergibt das 8,2 Quadratmeter pro Person. Kein Raum für Küche, kein Raum für Bad, kein Raum für Rechtmäßigkeit. Jeder, der je eine Wohnung gemietet oder gebaut hat, weiß: So etwas fällt auf. Beim Einzug. Beim Nachbarn. Beim Stromanbieter. Beim Meldeamt. Und ganz sicher beim Jobcenter.
Aber der Punkt ist nicht nur rechnerisch. Er ist strukturell.
Unterlagen sind keine Vermutungen, keine Spekulation. Sie basieren auf Begehungen, auf Bauplänen, auf Berechnungen. Sie sind die stillen Chronisten eines Gebäudes – keine Meinung, sondern Maß. Und damit genau das, was in einer aufgeheizten Debatte oft fehlt: eine messbare, unaufgeregte Grundlage. Ganz entspannt.
Diese Grundlage zeigt: Es gibt keine geheimen Flügel. Keine Hinterzimmer mit Ausbau. Keine Stockwerke, die nachträglich über Nacht entstanden sind. Was da ist, ist das, was versichert ist. Und was versichert ist, ist das, was auch bewohnt werden darf.
Natürlich – man könnte einwenden: Auch auf 400 m² ließe sich eine Überbelegung konstruieren. Vielleicht. Aber nicht, wenn man die Verträge kennt. Nicht, wenn man die BG-Nummern vorliegen hat. Nicht, wenn man weiß, dass jede Bedarfsgemeinschaft geprüft wird – mitsamt Quadratmeterangabe, Mietkosten und Haushaltszusammensetzung.
Und genau das ist der Punkt: Die Fläche ist nicht nur eine Zahl – sie ist ein Kontrollinstrument. Sie ist das Maß, an dem sich Verwaltung, Gesetz und Sozialleistung orientieren. Wer hier eine „verdeckte Massenbelegung“ vermutet, müsste nicht nur die Fläche leugnen. Sondern gleich das ganze Verwaltungssystem.
Es ist nicht die Fläche, die eine Behauptung widerlegt. Es ist die Logik, die sich aus ihr ergibt.
Denn jede Wohnung hat eine Tür. Einen Stromanschluss. Eine Wasserleitung. Einen Namen an der Klingel. Und genau das wurde geprüft – mehrfach, systematisch. Von Versicherern. Von Behörden. Von denen, die für die Kontrolle zuständig sind.
Wenn man von „30 bis 50 Personen“ spricht – wie soll das physisch gehen? Wo genau sollen sie wohnen? Wer soll ihnen Platz gemacht haben? Wo bleiben die Möbel? Wo wird gekocht, geschlafen, gelernt, gelebt?
Fragen, die einfach klingen. Aber es hat eine große Wirkung. Weil sie zeigen: Hier geht es nicht um Zahlen allein. Sondern um das Verhältnis zwischen Zahl und Raum. Und dieses Verhältnis ist nicht interpretierbar. Es ist – im wahrsten Sinne des Wortes – messbar.
Vielleicht ist das die große Ironie dieser Debatte: Dass dort, wo alles unsicher scheint, die einfachste Klarheit in der Fläche liegt. In der Wand. Im Boden. Im Mietvertrag.
Und dass genau diese Klarheit bislang überhört wurde – weil man sich lieber an eine Zahl geklammert hat, die nie in der Realität geprüft wurde.
Die Fläche spricht nicht. Aber sie widerspricht. Deutlich. Still. Und unübersehbar.
Anzahl der Wohnungen und registrierten Bewohner:innen
Wenn jeder Name bekannt ist – und trotzdem gerätselt wird
Man muss sich das einmal vorstellen: Da stehen zwei Häuser, mitten in einer kleinen Stadt. Sie sind weder anonym noch verlassen. Keine Lost Places. Keine Grauzone. Kein Raum, der dem Zugriff des Staates entzogen wäre. Und doch tun viele so, als wisse man nicht, wer dort wohnt.
Dabei ist alles da: Die Wohnungen sind vermietet. Die Mietverträge sind registriert. Die Bewohner:innen sind angemeldet. Jeder Name, jede Zahl, jede Adresse liegt den zuständigen Behörden vor – vom Meldeamt über das Jobcenter bis zur Hausverwaltung.
Acht Wohnungen, regulär vermietet. Jede davon mit einem klar zugeordneten Mietverhältnis. Kein Mietmodell zur Zwischennutzung. Keine überbelegten Schlafstellen. Kein anonymes Abtauchen in einem unübersichtlichen System. Sondern: ganz normale Menschen, mit ganz normalen Lebensläufen – und ganz normalen Rechten.
Und trotzdem hält sich der Verdacht. Warum?
Vielleicht, weil „normal“ zu wenig ist, wenn man eine Geschichte erzählen will. Vielleicht, weil es einfacher ist, Unsicherheit zu behaupten, als Klarheit zu bestätigen. Vielleicht, weil manche lieber hören: „Da weiß keiner, wer wohnt“ – als zu akzeptieren: „Da wohnt jemand. Ganz legal.“
Dabei ist die Zahl der Bewohner:innen nicht nur schätzbar. Sie ist bekannt. Nicht gefühlt – sondern dokumentiert. Im Melderegister. In den Jobcenterakten. In den Bestätigungen, die jeder Mieter beim Einzug vorlegt.
Im Juni 2025, zu Beginn der öffentlichen Debatte, sind 13 Personen in den beiden Häusern offiziell gemeldet. Darunter mehrere Kinder, drei Haushalte mit zwei Elternteilen, zwei Alleinerziehende. Keine Großgruppe. Keine Clanstruktur. Keine Massenwohnung. Sondern das, was viele in Loitz ebenfalls kennen: Wohngemeinschaften, junge Familien, Mehrgenerationenhaushalte.
Wenn also jemand behauptet, dort lebten „30 bis 50 Personen“, dann muss er eine zweite Realität meinen. Eine, die es nur im Kopf gibt – oder in der Schlagzeile. Denn keine Hausverwaltung, kein Meldeamt, kein Polizeibericht kennt diese Zahl.
Und das ist der entscheidende Punkt: In einem funktionierenden Verwaltungsapparat ist die Bewohnerzahl nicht geheim. Sie ist meldepflichtig. Und kontrollierbar. Und vor allem: nachvollziehbar.
Jede Anmeldung erfordert eine Wohnungsgeberbestätigung. Jeder Antrag auf Wohngeld oder Jobcenter-Leistung muss die Haushaltsgröße offenlegen. Jeder Zuzug wird dokumentiert. Jeder Nachmieter wird geprüft.
Das ist keine Theorie. Das ist Alltag – überall in Deutschland. Und auch in Loitz.
Es gibt keine Hinweise darauf, dass Bewohner:innen in den Häusern der Marktstraße 151 und 191 „durchgeschleust“ wurden. Es gibt keine unerklärlichen Abweichungen bei Wasser, Strom, Müll. Keine Beschwerden über Lärm durch Dutzende Menschen. Keine Indizien, die auf eine systematische Verheimlichung von Wohnrealität hindeuten würden.
Was es gibt, ist eine Behauptung – und das hartnäckige Weiterschreiben dieser Behauptung. Aber die Faktenlage widerspricht ihr – an jedem einzelnen Punkt.
Wenn 13 Personen auf acht Wohnungen verteilt leben, ergibt das einen Durchschnitt von 1,6 Bewohner:innen pro Wohnung. Kein ungewöhnlicher Wert. Eher unterdurchschnittlich – verglichen mit vielen Haushalten im ländlichen Raum.
Und dennoch wird der Eindruck erweckt, als sei hier etwas aus dem Ruder gelaufen.
Vielleicht, weil es nicht um die tatsächliche Anzahl der Bewohner:innen geht – sondern um ihre Herkunft. Ihre Namen. Ihre Sprache. Ihre Hautfarbe. Dinge, die in keiner Statistik stehen – aber in manchen Köpfen sehr präsent sind.
Doch das darf keine Grundlage sein. Nicht für politische Entscheidungen. Nicht für mediale Berichterstattung. Und schon gar nicht für pauschale Verurteilungen.
Die Namen der Bewohner:innen sind den Behörden bekannt. Ihre Wohnverhältnisse sind dokumentiert. Ihre Rechte sind geschützt.
Und wer das ignoriert, spricht nicht über eine Straße – sondern über ein Bild, das er selbst gezeichnet hat.
Ausschluss verdeckter Nutzung
Was sichtbar ist – und warum das Unsichtbare nicht einfach behauptet werden kann
Es gibt einen Satz, der in Diskussionen wie diesen gerne fällt: „Man weiß ja nicht, wer da noch alles wohnt.“ Er klingt harmlos. Offen. Fragend. Vielleicht sogar besorgt. Aber in Wirklichkeit ist er eine rhetorische Finte. Denn er unterstellt, ohne zu sagen. Er behauptet, ohne zu belegen. Und vor allem: Er weicht aus.
Denn genau das ist der Unterschied zwischen Sorge und Verdacht. Die Sorge fragt: Was ist da los? Der Verdacht sagt: Da stimmt was nicht. Und mit diesem Satz, mit diesem „Man weiß ja nicht...“, öffnet sich die Tür für alles, was gesagt werden soll – aber nicht gesagt werden darf.
Plötzlich ist die Rede von Matratzenlagern. Von Cousins, die nicht gemeldet seien. Von Schwagern und Swippschwagern, die „nachts reinkommen“. Von Zimmern, die keiner kennt. Und jedes Mal bleibt die entscheidende Frage unbeantwortet: Gibt es dafür irgendeinen Beleg?
In der Marktstraße nicht. Keine ungewöhnlichen Stromverbräuche. Keine auffälligen Müllmengen. Keine Beschwerden über „Dauerverkehr“ im Treppenhaus. Kein ungewöhnliches Aufkommen bei den Hausnebenkosten. Keine Polizeieinsätze wegen Lärmbelästigung durch große Gruppen. Nichts. Und genau das ist der Punkt.
Denn das, was viele für „unsichtbar“ halten, wäre in Wahrheit sehr sichtbar – wenn es denn da wäre.
Man darf nicht vergessen: Diese Häuser stehen nicht im Niemandsland. Sie stehen in einer kleinen Stadt. In Sichtweite zum Rathaus. Auf einem Abschnitt, der regelmäßig von Bauhof, Müllabfuhr und Nachbarn frequentiert wird. Jeder kennt jeden. Und jeder sieht, was passiert – oder eben nicht passiert.
Verdeckte Nutzung? In acht Wohnungen? In Häusern, deren Mieterinnen und Mieter auf Leistungen des Jobcenters angewiesen sind – und deren Mietverträge dort hinterlegt sind?
Das wäre nicht nur unwahrscheinlich. Das wäre ein Widerspruch in sich.
Denn: Wer Sozialleistungen bezieht, muss seine Wohnsituation offenlegen. Nicht einmal – sondern regelmäßig. Neue Personen im Haushalt? Müssen gemeldet werden. Zu viele Personen auf zu wenig Raum? Fällt auf. Spätestens bei der nächsten Prüfung. Oder der Nebenkostenabrechnung. Oder beim Wechsel des Stromanbieters.
Selbst wenn man ein misstrauischer Mensch wäre – und es sich leisten wollte, alles zu hinterfragen – es gäbe schlicht keinen plausiblen Weg, wie eine Massenunterbringung in diesen Häusern unbemerkt möglich wäre.
Und doch hält sich das Gerücht.
Weil es einfacher ist, mit dem Finger auf andere zu zeigen, als sich mit den eigenen Vorurteilen auseinanderzusetzen. Weil der Begriff „verdeckte Nutzung“ eine Art Joker ist – man kann ihn immer ziehen, wenn einem die Beweise fehlen. Und weil viele gar nicht merken, wie tief rassistische und klassizistische Zuschreibungen in solchen Andeutungen mitschwingen.
Denn sind wir ehrlich: Wenn in diesen Häusern zehn alleinlebende Deutsche wohnen würden – gäbe es diese Debatte?
Oder braucht es erst Namen, die nicht Müller oder Schulze heißen, damit eine Wohnung zum „Verdacht“ wird?
Das ist keine Anklage. Aber eine Einladung zum Hinschauen. Zum Prüfen. Und zum Reflektieren.
Denn wo alles dokumentiert ist – die Fläche, die Zahl der Wohnungen, die Zahl der Bewohner:innen, die Mietverhältnisse – da kann eine „verdeckte Nutzung“ nicht einfach behauptet werden, ohne sich selbst lächerlich zu machen. Oder schlimmer: ohne Menschen zu beschädigen, die nichts anderes getan haben als zu wohnen. Zu leben. Zu sein.
Die Unschuldsvermutung gilt nicht nur vor Gericht. Sie gilt auch in der öffentlichen Debatte. Und wer glaubt, dass jemand etwas verbirgt, muss es belegen – oder schweigen.
Wie ist Ihre Reaktion?































![7-Gedanken - [AUDIO] - Kreative Zeitzeugen in Wort und Bild](https://img.youtube.com/vi/cefF2A35Fv4/maxresdefault.jpg)












![Die Brücke über den Ibitzbach in Loitz [Playlist]](https://img.youtube.com/vi/U32rGgaVnp8/maxresdefault.jpg)
![Der Narr und der Zar - Das Spiel der Masken [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202504/image_430x256_67f8cc15b44ad.jpg)
![7-Gedanken: Als Fotograf das perfekte Portrait inszenieren [Playlist]](https://dreifisch.com/uploads/images/202410/image_430x256_6723de813c1d3.jpg)
![7-Gedanken: ORANGE, ein verbindender Farbton, aber keine Grundlage für alles [PLAYLIST]](https://img.youtube.com/vi/aj-yKeL1FAk/maxresdefault.jpg)




























































